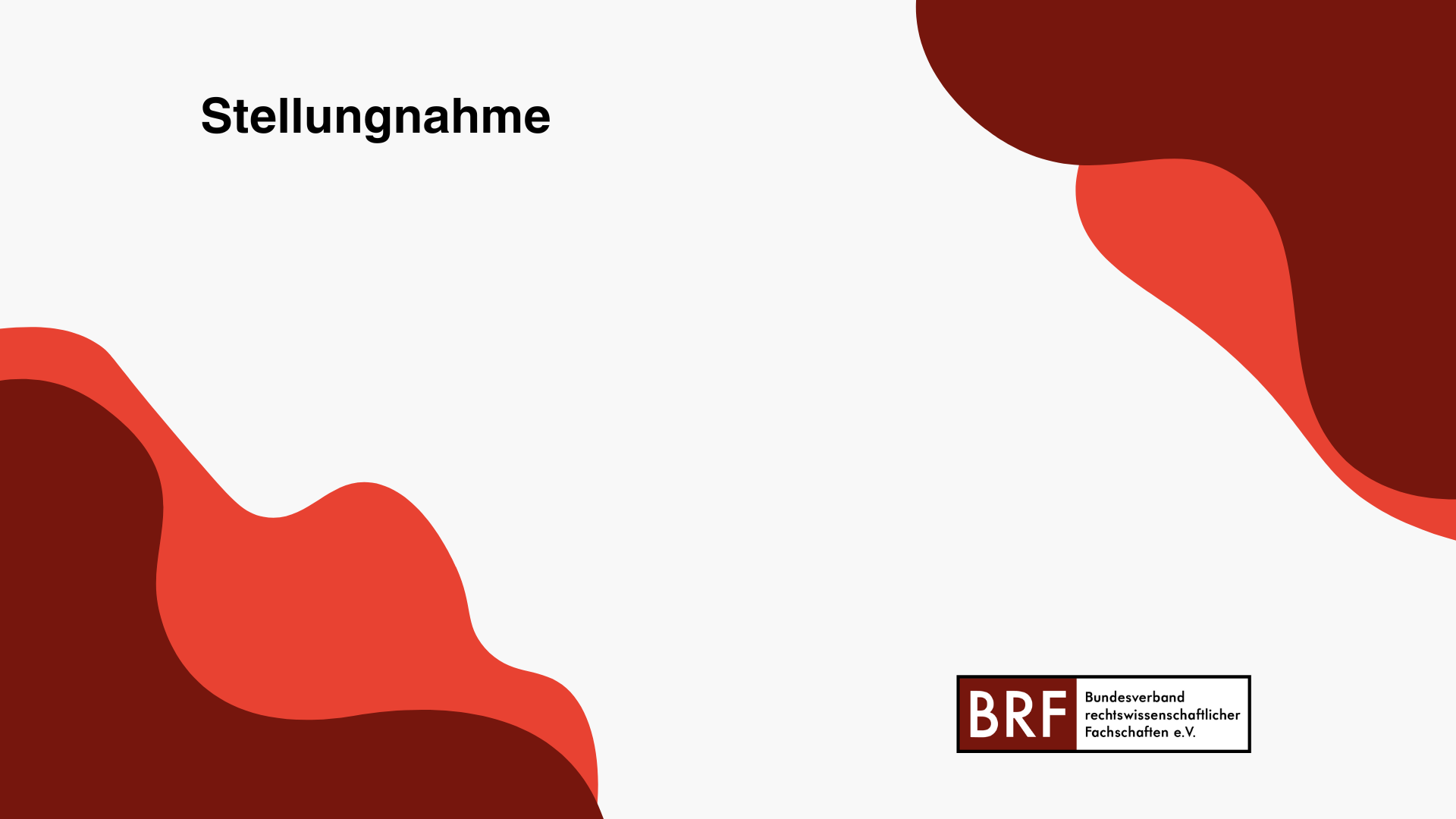17. November 2023
Dass die juristische Ausbildung reformbedürftig ist, wird immer wieder durch Erhebungen belegt: So zeigte die im September vom Bundesverband Absolvent:innenbefragung, dass nur jede:r dritte Jurastudierende das aktuelle rechtswissenschaftliche Studium weiterempfehlen würde. Auch die iur.reform-Studie deutet auf die Notwendigkeit von Reformen hin. 43 Reformvorschläge wurden unter den verschiedenen Gruppen von Akteur:innen in der juristischen Ausbildung zur Abstimmung stellt. Das Ergebnis überrascht: Während erwartungsgemäß einige Thesen von den verschiedenen Gruppen unterschiedlich stark unterstützt wurden, gibt es viele Thesen, deren Zustimmungswerte übereinstimmend in allen Gruppen hoch sind. Erfreulicherweise wird die dringende Reformbedürftigkeit der juristischen Ausbildung zunehmend auch von politischen Stakeholdern wahrgenommen. Im Folgenden soll, auf die im Antrag mit der Drucksache 8/2770 aufgeworfenen Punkte genauer eingegangen werden.
1. Verdeckte Zweitkorrekturen in den staatlichen Prüfungen
Die verdeckte Zweitkorrektur sollte verbindlich in den staatlichen Prüfungen in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Juristen (JAPrVO) festgeschrieben werden. Denn dass die:der Zweitkorrektor:in Kenntnis vom Votum der Erstkorrektur hat, beruht auf rein organisatorischen und fiskalischen Gründen. So wird angeführt, dass nur die offene Zweitkorrektur von den Korrigierenden akzeptiert wird und zudem Kosten spare. In der Praxis gibt es jedoch gewichtige Gründe, die für eine Einführung der verdeckten Zweitkorrektur sprechen. So wird durch eine Korrektur, bei der die:der Zweitkorrektor:in das Votum der Erstkorrektur nicht kennt, dem Ankereffekt bei der Bewertung vorgebeugt. Der Ankereffekt beschreibt, dass betroffene Personen sich bei Ihrer Entscheidungsfindung (hier der Bewertung) durch vorhandene Informationen (hier dem Erstvotum) beeinflussen lassen, ohne, dass dies betroffenen Personen sich einer Beeinflussung bewusst ist. Dieser Effekt führt bei einer offenen Zweitkorrektur dazu, dass die an sich schon subjektive Korrektur noch anfälliger für Benachteiligung ist. Dabei soll durch die Zweitkorrektur gerade eine objektivere Bewertung gewährleistet werden.
Eine verdeckte Zweitkorrektur, welche sich zweier gleichwertiger Voten bedient, wirkt dieser Subjektivität entgegen und steigert so auch die Transparenz und Akzeptanz des Notenbildungsverfahren. Diese Auswirkungen werden nicht erreicht, wenn, wie fraglicherweise behauptet, eine verdeckte Zweitkorrektur faktisch bereits größtenteils praktiziert wird, obwohl es nirgends festgeschrieben ist.
2. Diversere Besetzung der Prüfungsausschüsse
Die Festsetzung, dass Prüfungsausschüsse in den mündlichen Teilen der staatlichen Pflichtfachprüfung sowie der zweiten Staatsprüfung divers zu besetzen sind, ist zu begrüßen. So belegte bereits 2017 eine Studie, die die Ergebnisse der staatlichen Pflichtfachprüfung und der zweiten Staatsprüfung in NordrheinWestfalen auf Unterschiede der Benotung untersuchte, dass Frauen im mündlichen Teil durchschnittlich schlechtere Noten als Männer erhalten und Personen mit Indikatoren für einen Migrationshintergrund im mündlichen Teil deutlich schlechter abschneiden als solche ohne diese Indikatoren.
Diverse Prüfungsausschüsse haben nach dieser Untersuchung die Möglichkeit die Benachteiligung von Frauen auszugleichen, indem mindestens eine Frau Mitglied des Ausschusses ist. Über diesen bewiesenen Effekt hinaus haben diverse Prüfungsausschüsse das Potential, Vorbilder für die Prüflinge aufzuzeigen und unter Umständen den Prüfungsstress für nicht-männliche Personen oder solche mit Migrationshintergrund zu reduzieren, indem ihnen Personen mit ähnlicher Lebenserfahrung gegenübersitzen.
Alleinig zu bestimmen, dass Prüfungsausschüsse divers zu besetzen sind, reicht hier jedoch nicht aus: Einer entsprechenden Änderung der JAPrVO müssten auch Maßnahmen folgen, um mehr Mitglieder der angesprochenen Personenkreise zu motivieren sich für das Prüfen in den mündlichen Teilen zu melden. Nur so kann eine diversere Besetzung von Prüfungsausschüssen in der Praxis zur Steigerung der Chancengleichheit führen, welche eine diversere Justiz begünstigt.
3. Erweiterung des Pflichtfachstoffkatalogs nur unter Streichung von bestehenden Inhalten
Die Forderung, dass der Pflichtfachstoffkatalog nur bei Streichung von bestehenden Inhalten erweitert wird, trifft zwar im Kern den richtigen Punkt, geht jedoch nicht weit genug. Bereits jetzt empfinden 76,30 % der befragten Absolvent:innen den Prüfungsstoff der staatlichen Pflichtfachprüfung als zu umfangreich.7 In seinem aktuellen Umfang führt der Pflichtfachstoffkatalog dazu, dass Auswendiglernen anstelle von Systemverständnis belohnt wird. Somit steht der aktuelle Pflichtfachstoffkatalog in Teilen konträr zum eigentlichen Ausbildungsziel: Der Ausbildung von Einheitsjurist:innen, welche trotz fachlich breiter Ausbildung später in den verschiedensten Berufen arbeiten können, selbst wenn die benötigten Normen gerade nicht Teil des Pflichtfachstoffkatalogs waren. Dies ist nur durch Systemverständnis und der Beherrschung des juristischen Handwerkszeugs möglich.
Selbst bei einer Beibehaltung des aktuellen Pflichtfachstoffkatalog wächst der prüfungsrelevante Stoff durch neue nationale und internationale Regelungen sowie der Weitentwicklung in der Rechtsprechung immer weiter an. Dieser Tatsache muss mit einer Reduzierung des Pflichtfachstoffs entgegengewirkt werden. Hierbei ist es wichtig, die prüfungsrelevanten Stoffe nicht einseitig, sondern unter Abwägung der verschiedenen Argumente der Akteur:innen in der juristischen Ausbildung auszuwählen und diese Auswahl regelmäßig zu evaluieren.
4. Einführung eines integrierten Bachelors
Die Einführung eines integrierten Bachelor of Laws in Sachsen-Anhalt ist zu befürworten. Dies ermöglicht die Verleihung eines Abschlusses, ohne die staatliche Pflichtfachprüfung abzulegen, und honoriert damit die Leistungen, die Studierenden während ihres Studiums erbracht haben. Hierbei stellt der Bachelor keine Konkurrenz zur ersten Prüfung dar, die zusammen mit der zweiten Staatsprüfung die Voraussetzung zur Richterbefähigung bleibt, da die meisten Studierenden weiter diese als Anschluss anstreben.
Vielmehr verliert die erste Prüfung durch die Einführung des integrierten Bachelors ihren „Alles-odernichts-Charakter“ und senkt so die (berechtigte) Angst der Prüflinge, am Ende ihres Studiums, ohne einen Abschluss dazustehen. Diese Angst trägt dazu bei, dass Prüflinge in der Vorbereitungszeit auf die staatliche Pflichtfachprüfung einem – auch im Vergleich zu anderen Studiengängen – hohen psychischem Druck unterliegen, welcher sich nicht selten in Anzeichen von chronischem Stress, Ängstlichkeit und teilweise Depressivität äußert. Diese Effekte können durch die Einführung eines integrierten Bachelors abgemildert werden. Weiter planen mittlerweile viele andere Fakultäten bzw. Bundesländer eine Einführung, sodass bei Fehlen dieser Möglichkeit ein Standortnachteil für Sachsen-Anhalt entstehen würde, wenn jetzt nicht entsprechende Schritte ergriffen werden, die eine schnellstmögliche Einführung vorbereiten.
5. Weiterer Reformbedarf
Neben den bereits im Antrag erwähnten Möglichkeiten sollten weitere konkrete Maßnahmen für eine Verbesserung der juristischen Maßnahmen ergriffen werden. So sollte das universitäre Repetitorium des juristischen Bereichs der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gestärkt und ausgebaut werden. Dieses muss, als Kerngebiet der universitären Aufgaben der juristischen Fakultäten,10 langfristig eine ernsthafte Alternative zu kommerziellen Repetitorien darstellen, um die juristische Ausbildung kostengünstig für alle Bevölkerungsgruppen zu öffnen.
Auch die Ermöglichung der praktischen Studienzeit in der Vorlesungszeit kann dazu beitragen, die juristische Ausbildung barriereärmer zu machen. Studierende erhalten so vereinfacht die Möglichkeit, in der vorlesungsfreien Zeit zu arbeiten und sich somit ihr Studium zu finanzieren. Zudem führt die Ermöglichung der praktischen Studienzeit in der Vorlesungszeit zu einem selbstbestimmteren Studium, was sich allgemein an die Situation des:der Einzelnen besser anpassen lässt.11 Aus diesen Gründen sollte sich Sachsen-Anhalt im Bundesrat dafür einsetzen, § 5a Abs. 3 DRiG entsprechend zu ändern und anschließend die JAPrVO entsprechend anpassen.
6. Fazit
Über diese konkreten Vorschläge zur Verbesserung der juristischen Ausbildung in Sachsen-Anhalt hinaus gibt es jedoch einen tiefergreifenden Reformbedarf, um die juristische Ausbildung zeitgemäß zu gestalten. Die Vorschläge können nur als erste Maßnahmen verstanden werden, welche durch ein dauerhaften Monitoring evaluiert werden. Ein solches Monitoring sollte zudem weiteren Reformbedarf identifizieren und hierauf proaktiv weitere Maßnahmen aufzeigen, um die bereits genannten Missstände nachhaltig zu beheben. Das Monitoring muss institutionalisiert in Form eines Gremiums durch die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister [sic!] eingesetzt werden, um länderübergreifend legitimiert zu sein und eine Fortdauer zu gewährleisten. Zudem hat ein solches Gremium das Potential, die juristische Ausbildung aus den unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen Akteur:innen zu begleiten und somit langfristig mit immer neuen Reformvorschlägen dafür zu sorgen, dass die juristische Ausbildung zukunftsorientiert gestaltet ist.