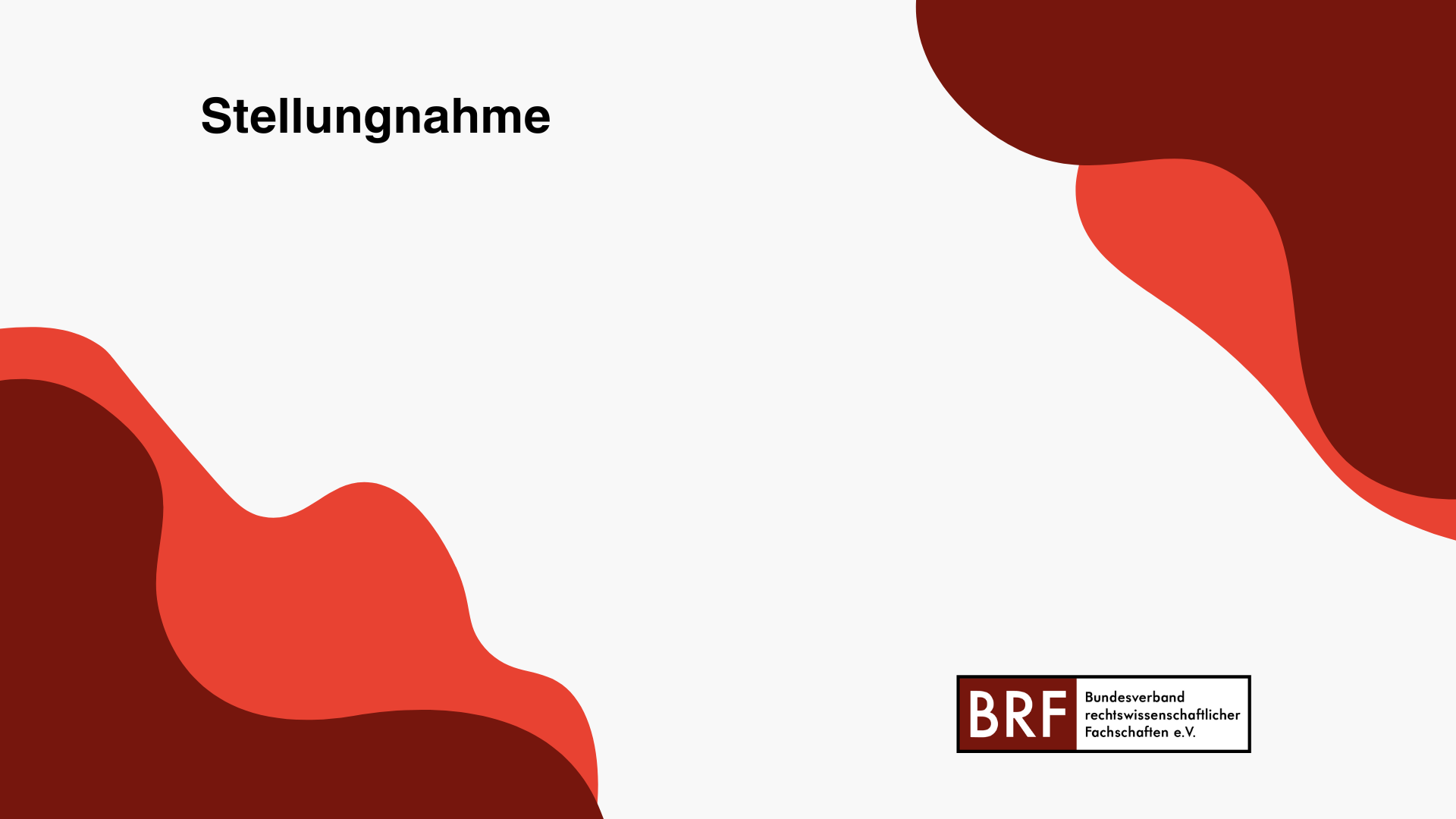22. Mai 2024
Sehr geehrte Abgeordnete des Thüringer Landtags,
gerne nehmen wir zu den Drucksachen 7/9427 und 7/9649 Stellung.
Seit Jahren fordert der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (BRF) die Integration eines Bachelor of Laws in das Studium der Rechtswissenschaft, um die vor Abschluss der ersten Prüfung erbrachten Leistungen der Studierenden zu honorieren und den hohen psychischen Druck im Jurastudium abzumildern. Aus diesen Gründen begrüßt der BRF grundsätzlich die Gesetzesentwürfe der Fraktion der CDU (Drucksache 7/9427) sowie der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 7/9649). Dennoch sehen wir in beiden Entwürfen an einigen Stellen Nachbesserungsbedarf; auf diesen wird im folgenden Teil genauer eingegangen.
1. Welche Vorteile und welche Nachteile sehen Sie durch die jeweiligen Regelungen zu den Voraussetzungen für die Verleihung des Bachelorabschlusses in den beiden Gesetzesentwürfen?
Beide Gesetzesentwürfe setzen mit dem Abstellen auf die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen zur staatlichen Pflichtfachprüfung an der richtigen Stelle an. Die für die Zulassung erforderlichen Leistungen werden in der Regel innerhalb von sechs Semestern erbracht, was der Regelstudienzeit eines Bachelorstudiengangs mit 180 Credit Points entspricht.
Positiv hervorzuheben ist ferner, dass zunächst keine Leistungen, die nicht bereits im Studiengang Rechtswissenschaft mit dem Abschluss erste Prüfung gefordert sind, für die Beantragung des Bachelor of Laws erforderlich sind.
Dennoch schöpfen beide Gesetzesentwürfe nicht das volle Potential eines integrierten Bachelors aus. So sieht der Gesetzesentwurf mit der Drucksache 7/9427 vor, dass die Friedrich-Schiller-Universität Jena ihren Studierenden auf Antrag den Grad des Bachelor of Laws (LL.B.) verleihen könne, wenn diese nach dem 01.01.2018 die Zulassungsvoraussetzungen für die staatliche Pflichtfachprüfung erfüllt haben und eine Bachelorarbeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena bestanden haben. Diese Regelung wirft mehrere Fragen auf.
Zunächst ist nicht ersichtlich, warum der Universität – durch die Verwendung der Formulierung „kann“ – ein Ermessensspielraum bei der Verleihung des Bachelorgrades gewährt werden soll. Begrüßenswerter ist daher die Wortwahl des Gesetzentwurfs mit der Drucksache 7/9649, in welchem der Bachelorgrad zu verleihen „ist“.
Ferner sieht die Regelung zwar eine Rückwirkung vor, faktisch können durch die Formulierung „ihren Studentinnen und Studenten“ jedoch nur die die Personen die Verleihung eines Bachelorgrades beantragen, die noch an der Friedrich-Schiller-Universität Jena immatrikuliert sind. Da jedoch eine Rückwirkung vorgesehen ist, ist davon auszugehen, dass eine Beschränkung auf immatrikulierte Studierende nicht vorgesehen ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte diese Formulierung angepasst werden.
Dennoch schließt der Gesetzesentwurf in der aktuellen Form Personen aus, die das Studium bereits abgeschlossen haben. In § 6 Abs. 2 Nr. 2 Thüringer Juristenausbildungsgesetz-E der Drucksacke 7/9427 ist das Bestehen einer Bachelorarbeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena vorgesehen. Das Absolvieren einer Bachelorarbeit ist jedoch in dem Studiengang Rechtswissenschaft mit dem Abschluss erste Prüfung nicht vorgesehen. Zwar absolvieren die Studierenden innerhalb des Schwerpunktbereichsstudiums gem. § 16 der Prüfungsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena für die Schwerpunktbereichsprüfung vom 15. Mai 2007 eine wissenschaftliche Arbeit, die vom Umfang mit einer Bachelorarbeit vergleichbar ist, dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Bachelorarbeit im eigentlichen Sinne. Wird dennoch das Bestehen einer Bachelorarbeit vorausgesetzt, müssten Personen, die den Bachelorgrad verliehen bekommen möchten, eine zusätzliche Leistung erbringen – was Personen, die nicht mehr immatrikuliert sind, ausschließen würde. Um dem Grundgedanken des vollständig integrierten Bachelors gerecht zu werden, bietet sich eine Anrechnung der wissenschaftlichen Arbeit als Bachelorarbeit an. Dies liegt ohne eine entsprechende gesetzliche Regelung zur Anrechnung jedoch im Ermessen der Universität.
Sinnvoll wäre, sowohl die im Rahmen des Schwerpunktbereichsstudiums angefertigte wissenschaftliche Arbeit als auch eine reguläre Bachelorarbeit anzuerkennen. Personen, die sich den Bachelorgrad verleihen lassen möchten, könnten so entscheiden, ob sie regulär das Schwerpunktbereichsstudium durchlaufen oder eine zusätzliche Bachelorarbeit anfertigen möchten. Dies schafft außerdem eine zusätzliche Flexibilität bei der Gestaltung des Studienverlaufes, da Personen, die vor Absolvierung der staatlichen Prüfung einen Bachelorabschluss „in der Tasche“ haben möchten, nicht gezwungen sind, zuerst das Schwerpunktbereichsstudium zu durchlaufen.
Im Gegensatz dazu wird im Gesetzesentwurf mit der Drucksache 7/9649 keine Bachelorarbeit oder eine äquivalente Leistung gefordert. Hier besteht die Gefahr, dass der Abschluss an anderen Hochschulen im In- und Ausland nicht wie ein regulärer Bachelor of Laws anerkannt wird. So sieht der Beschluss der Kultusministerkonferenz [sic!] vor, dass in Bachelor- und Masterstudiengängen obligatorisch eine Bachelor- oder Masterarbeit anzufertigen ist. Daher ist zu empfehlen, eine mindestens bachelorarbeitsäquivalente Leistung zur Beantragung des Bachelorgrades vorauszusetzen und den Studierenden dabei freizustellen, ob sie die für den Abschluss des Schwerpunktbereichsstudiums erforderliche wissenschaftliche Arbeit oder eine gesonderte Bachelorarbeit anfertigen möchten.
2. Wie beurteilen Sie im Vergleich zum integrierten Bachelor insbesondere einen interdisziplinären LL.B.?
Interdisziplinäre Bachelor of Laws dienen der Verknüpfung der Rechtswissenschaften mit anderer Fachdisziplinen und sprechen insbesondere Studierende an, die von vorherein keinen klassischen juristischen Beruf anstreben. Im Gegensatz dazu fungiert der integrierte Bachelor of Laws als Zwischenabschluss, auf den in der Regel der Abschluss der ersten Prüfung folgt. Beide Bachelor sprechen daher verschiedene Zielgruppen an und bilden für unterschiedliche Berufsfelder aus. Die Gefahr, dass eine signifikante Anzahl künftiger Studierender sich gegen einen interdisziplinären Bachelor und für einen integrierten Bachelor entscheiden, sieht der BRF nicht gegeben. Die Einrichtung und Förderung beider Arten des Bachelor of Laws hält der BRF für sinnvoll.
3. Sehen Sie Alternativen zur Einführung eines integrierten Bachelors?
Alternativen, die gleich geeignet sind, die oben genannten Vorteile des integrierten Bachelors abzudecken, sind für uns nicht ersichtlich.
4. Welche Tätigkeiten im öffentlichen Dienst können statt von Volljuristen auch von LL.B.-Absolventen ausgeübt werden?
Als studentische Interessenvertretung hält sich der BRF nicht für ausreichend qualifiziert, um diese Frage zu beantworten.
5. Müssen Zulassungsvoraussetzungen bzw. Normen der Einstiegsanforderungen für Angestellte im öffentlichen Dienst bzw. Beamte geändert werden, um solche Stellen auch für LL.B.-Absolventen zugänglich zu machen?
Als studentische Interessenvertretung hält sich der BRF nicht für ausreichend qualifiziert, um diese Frage zu beantworten.
6. Wie bewerten Sie die Einführung eines integrierten Bachelorgrades in das rechtswissenschaftliche Studium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena?
Die Einführung eines Bachelorgrades in das rechtswissenschaftliche Studium an der Friedrich-SchillerUniversität Jena begrüßt der BRF ausdrücklich. Mit diesem Schritt würde sie eine Vorbildfunktion für andere Hochschulen einnehmen.
Personen, die die Zulassungsvoraussetzungen der staatlichen Pflichtfachprüfung erfüllen (und eine Bachelorarbeit oder äquivalente Leistung bestanden haben) haben durch das Bestehen etlicher Prüfungen gezeigt, dass sie das juristische Handwerk beherrschen und ein grundlegendes rechtliches Verständnis besitzen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es notwendig, erworbene Qualifikationen auch mit einem Hochschulabschluss anzuerkennen. Zudem laufen durch die Verleihung eines integrierten Bachelor of Laws die Hochschulressourcen, die für Studierende aufgewendet wurden, die sich gegen die Absolvierung der ersten Prüfung entscheiden oder diese endgültig nicht bestanden haben, nicht ins Leere.
Schließlich ist der integrierte Bachelor nicht nur für die Personen vorteilhaft, die sich gegen das Absolvieren der staatlichen Pflichtfachprüfung entscheiden, sondern nimmt der ersten Prüfung auch ihren Alles-oder-Nichts-Charakter. Auf diese Weise wird die emotionale Belastung der Studierenden gesenkt, die insbesondere vor der staatlichen Pflichtfachprüfung sehr hoch ist.
7. Sehen Sie in der Einführung die Möglichkeit der Attraktivitätssteigerung für die Universität und für das Studium der Rechtswissenschaften?
Durch Gespräche mit den verschiedenen Fachschaften, Studierenden und Studieninteressierten konnten wir über die letzten Jahre feststellen, dass die Möglichkeit, einen (integrierten) Bachelor of Laws zu erwerben, einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Studienortwahl der Studierenden hat. In dieser Hinsicht ist eine Attraktivitätssteigerung der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu erwarten.
Zudem sorgt die Einführung eines Zwischenabschlusses in das Jurastudium in Form des Bachelor of Laws für eine allgemeine Steigerung der Attraktivität des Studienganges. Das Studium der Rechtswissenschaft mit dem Abschluss erste Prüfung ist mit einer Regelstudienzeit von zehn Semestern vergleichsweise sehr lang und bietet noch vielerorts erst mit der ersten Prüfung einen berufsqualifizierenden Abschluss. Dies geht mit einem erhöhten finanziellen Risiko einher. Besonders für Personen, die finanziell schwächer gestellt sind, bietet der integrierte Bachelor als berufsqualifizierender Zwischenabschluss finanzielle Sicherheit.
8. Wie bewerten Sie den Nutzen eines juristischen Bachelor-Abschlusses für die Absolventen auf dem Arbeitsmarkt und für ein fortgesetztes Studium in einem anderen Bereich?
Nicht alle Berufe, in denen juristisches Wissen benötigt wird, müssen zwangsläufig von Volljurist:innen ausgeübt werden. Sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der privaten Wirtschaft gibt es inzwischen immer mehr Berufsfelder, für die Personen mit einem Bachelor of Laws ausreichend qualifiziert sind. Daneben besteht die Möglichkeit, einen konsekutiven Masterstudiengang zu absolvieren und sich in einem bestimmten Bereich zu spezialisieren.
9. Welche Anforderungen sollten Ihrer Ansicht nach an die Vergabe des Abschlusses gestellt werden? Welche Möglichkeiten sehen Sie, im Studium erbrachte Leistungen für die Vergabe des Bachelorabschlusses anzurechnen und eine faire Umrechnung der Noten zu erreichen?
Wie bereits oben beschrieben, halten wir das Abstellen auf das Erfüllen der Zulassungsvoraussetzungen für die staatliche Pflichtfachprüfung für sinnvoll. Zudem sollte das Bestehen einer Bachelorarbeit oder äquivalenter Leistung, wie beispielsweise die wissenschaftliche Arbeit, erforderlich sein. In jedem Fall sollte die wissenschaftliche Arbeit als Bachelorarbeit angerechnet werden können, um eine Zusatzbelastung der Studierenden zu vermeiden und dem Namen eines integrierten Bachelors gerecht zu werden.
Die Bachelornote sollte sich grundsätzlich aus allen für die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die staatliche Prüfung erforderlichen Leistungen zusammensetzen. In die Note könnten dabei die Leistungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 JAPO sowie § 16 Abs. 2 Nr. 1, 2 JAPO einfließen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass auch im Ausland erbrachte und nach § 16 Abs. 3 JAPO anrechenbare Leistungen einbezogen werden können.
nsichtlich der Umrechnung von Punkten auf der juristischen Punkteskala in Dezimalnoten ist von einer Umrechnung ohne Einbeziehung der Besonderheiten der juristischen Notengebung abzuraten. Bewertungen im Bereich von „sehr gut“ auf der juristischen Punkteskala werden nur von etwa 6 % Prozent der Absolvent:innen erreicht, während ein „sehr gut“ im Bologna-System deutlich häufiger vergeben wird. Das führt bei einer gradlinigen Umrechnung der Punktzahlen zu vergleichsweise schlechten Bachelornoten. So reicht ein in der juristischen Ausbildung überdurchschnittlich gutes Ergebnis von etwa neun Punkten nur für eine durchschnittliche Bachelornote von 2,3. Gerade vor dem Hintergrund, dass an anderen Hochschulen für integrierte Bachelor of Laws weniger strenge Umrechnungsschlüssel angewendet werden und nicht-integrierte Bachelor das Problem der Umrechnung nicht zu lösen haben, wirkt sich eine solche Note besonders dann zum Nachteil der Absolvent:innen aus, wenn potenzielle Arbeitgeber:innen nicht mit der juristischen Notenskala vertraut sind. Die fehlende unmittelbare Vergleichbarkeit sollte bei der Erstellung einer Umrechnungstabelle daher in jedem Fall beachtet werden.
10. Mit welchen zusätzlichen anderweitigen als in den Gesetzesentwürfen genannten Maßnahmen kann bzw. sollte ggf. auf die Bedürfnisse der Studierenden eingegangen werden?
Am Jurastudium können insbesondere die damit einhergehende hohe emotionale Belastung, die vergleichsweise sehr homogene Studierendenschaft, die fehlende Praxisnähe sowie sehr subjektiv empfundene Klausurbewertungen kritisiert werden. Diese Kritikpunkte können durch die folgenden Maßnahmen abgemildert werden.
Neben der Einführung eines integrierten Bachelor of Laws lässt sich der psychische Druck im Jurastudium außerdem durch die Einrichtung und den Ausbau von Beratungsangeboten senken. Auch die Ermöglichung eines Notenverbesserungsversuchs unabhängig von der Wahrnehmung des Freiversuchs senkt den Druck auf Studierende, das Studium zwangsläufig in Regelstudienzeit zu absolvieren. Insbesondere Personen, die mangels Unterstützung durch ihr Elternhaus neben dem Studium arbeiten oder Care-Arbeit leisten müssen, werden so emotional entlastet.
Um die Diversität im Jurastudium zu steigern, sollten an den Fakultäten und Fachbereichen Mentoringangebote für Studierende eingerichtet und/oder ausgebaut, das Lehr- und Verwaltungspersonal mit Diversitätskompetenz aus- und fortgebildet und der Ellenbogenmentalität im Jurastudium durch die Förderung einer respektvollen Studienkultur entgegengewirkt werden. Für konkretere Ausführungen sei auf die von der 8. Zwischentagung Halle (Saale) 2024 verabschiedete Resolution zur Diversität in der juristischen Ausbildung (Diversitätsresolution) verwiesen.
Verglichen mit anderen Bundesländern sind in Thüringen außerdem deutlich weniger Hilfsmittel in der staatlichen Pflichtfachprüfung zugelassen. Während Bremen beispielsweise unbegrenzt Unterstreichungen, Paragrafenverweise und Register zulässt, sind in Thüringen lediglich Register zu Beginn eines Gesetzes erlaubt. Durch eine Liberalisierung der Hilfsmittelverordnungen kann durch relativ geringen Aufwand eine Anpassung der Prüfungsbedingungen an die tatsächliche Praxis unternommen werden.
Schließlich kann den als sehr subjektiv empfundenen Bewertungen in der staatlichen Pflichtfachprüfung durch die Einführung einer verdeckten Zweitkorrektur entgegengewirkt werden.
Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um solche, die mit relativ geringem Zeit- und Kostenaufwand umgesetzt werden können.
11. Inwiefern sind Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Studienstandortes Jena notwendig, um die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber zu erhöhen?
Über die Anzahl der Bewerber:innen liegen dem BRF keine Zahlen vor, weshalb wir die Notwendigkeit einer Attraktivitätssteigerung nicht beurteilen können.
12. Sind Ihnen Erfahrungswerte von anderen Hochschulen, die den juristischen Bachelorabschluss eingeführt haben, bekannt und wie bewerten Sie diese Erfahrungen anderer Universitäten mit Blick auf die Einführung des Bachelors an der FSU?
Als bundesweite Interessenvertretung hat der BRF die Einführung verschiedener integrierter Bachelor of Laws im Bundesgebiet begleitet. Dabei muss zunächst zwischen der Einführung eines akkreditierten Bachelors als eigener Studiengang und der Verleihung des Bachelorgrades kraft Gesetzes unterschieden werden.
Zwar ist eine Akkreditierung aufgrund der einhergehenden Qualitätssicherung und Evaluation zu begrüßen, gleichzeitig gehen damit jedoch höhere Kosten und gegebenenfalls Probleme bei der nachträglichen Verleihung des Abschlusses einher. So ermöglicht die Universität des Saarlandes voraussichtlich lediglich eine Verleihung des Bachelorgrades an Studierende, die ihr Studium nach dem 01.10.2023 aufgenommen haben; an der Universität Bremen darf das Schwerpunktbereichsstudium oder die gesamte erste Prüfung nicht vor dem 01.10.2024 abgeschlossen oder das Schwerpunktbereichsstudium oder die staatliche Pflichtfachprüfung nicht endgültig nicht bestanden worden sein. Auch vor dem Hintergrund der Dauer des Akkreditierungsverfahrens ist die Verleihung kraft Gesetzes zu begrüßen.
Problematisch könnte sich bei der Verleihung des Bachelorgrades kraft Gesetzes dessen Anerkennung und die Befähigung zur Aufnahme eines konsekutiven Masterstudienganges auswirken. Daher ist die Einbeziehung einer bachelorarbeitsäquivalenten Leistung zu empfehlen. Auch eine zusätzliche Evaluation, die im Rahmen eines akkreditierten Studienganges automatisch erfolgen würde, sollte als Qualitätssicherungsmaßnahme vorausgesetzt werden.
13. Wie bewerten Sie die Möglichkeit einer nachträglichen Vergabe des Abschlusses bei Erfüllen der Voraussetzungen?
Eine rückwirkende Verleihung des Bachelorgrades ist grundsätzlich zu begrüßen. Zu den Voraussetzungen der Studierendeneigenschaft und der Anfertigung einer Bachelorarbeit im Gesetzesentwurf mit der Drucksache 7/9427 sei auf Frage 1 verwiesen.
Um eine Abwanderung der Studierenden, die den Stichtag knapp nicht erreichen, in andere Bundesländer zu vermeiden, ist es sinnvoll, die Zeiträume für eine nachträgliche Verleihung an bereits existierende anzugleichen. In Nordrhein-Westfalen wird aktuell der 01.04.2017 als Stichtag für eine rückwirkende Verleihung angestrebt.
Würde man auch in Thüringen diesen Stichtag zugrunde legen, ließen sich bundesweit einheitlichere Bedingungen schaffen und weitere Ressourcen der Hochschulen sinnvoll eingesetzt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit beiden Gesetzesentwürfe die richtige Intention verfolgt wird. Lediglich die Beschränkung auf (immatrikulierte) Studierende und die Voraussetzung, eine klassische Bachelorarbeit zu absolvieren in dem Gesetzesentwurf mit der Drucksache 7/9427 sowie die fehlende bachelorarbeitsäquivalente Leistung im Gesetzesentwurf mit der Drucksache 7/9649 bedürfen aus Sicht des BRF einer Anpassung. Hinsichtlich des Stichtages für die nachträgliche Verleihung sollte sich an bereits bestehenden Stichtagen für eine Verleihung des Bachelorgrades kraft Gesetzes orientiert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Frederik Janhsen (Vorsitzender), Emilia De Rosa (Stellv. Vorsitzende und & Vorständin für Öffentlichkeitsarbeit)