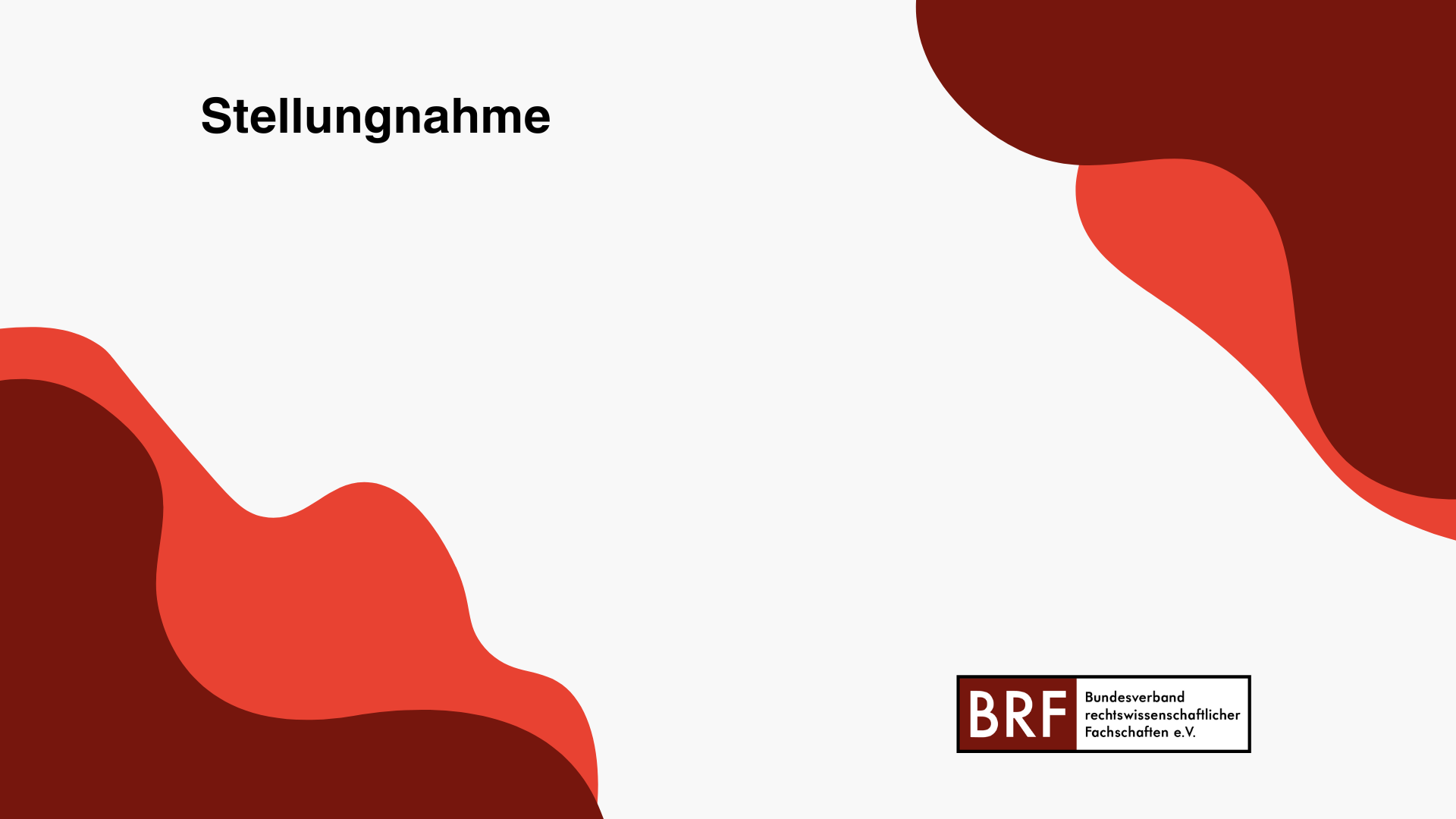29. April 2020
Seit mehreren Wochen lähmt das Coronavirus das tägliche Leben. Mitte März wurden die Universitäten geschlossen und Praktika weitgehend abgebrochen, was viele Brüche in der Studienplanung verursachte. Auch wenn die Universitäten mitunter sehr weite Bemühungen hin zu einem digitalen Semester anstellen, kann kein adäquater Ersatz für die fehlende Möglichkeit der Präsenz erreicht werden. Die Kommunikation wird durch technische Probleme oder Unerfahrenheit beeinträchtigt und die fehlende Nutzbarkeit der Infrastruktur der Fakultäten führt zu Nachteilen im Studium. Schließlich hat nicht jede*r zu Hause ein vergleichbar ruhiges Lernumfeld wie in der Bibliothek. Der Austausch mit Kommiliton*innen findet nicht statt und nicht alle haben technisch moderne Laptops oder schnelles Internet, sodass die Studienmöglichkeit eingeschränkt ist. Der Verlust des Nebenjobs, eine eigene Infektion, die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder die Pflege- oder Betreuung von Angehörigen oder Kindern tun ihr Übriges. Gleichwertige Studienmöglichkeiten sind nicht gegeben. Um die aktuelle Lage nicht auf dem Rücken der schwächsten Studierenden auszutragen, ist die Justizverwaltung in Bund und Ländern aufgerufen, einen Ausgleich hinsichtlich der Prüfungsmodalitäten zu treffen.
Im Einzelnen fordert der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften hierbei folgende Maßnahmen, um die Folgen der Pandemie auszugleichen:
- Optionsrecht für Prüfungen: Allen Studierenden muss die Möglichkeit offenstehen, infolge der belastenden Lernmöglichkeiten und der gesundheitlichen Gefahren ohne Vorlage eines Attests auf das Erbringen vorgesehener Prüfungsleistungen zu verzichten. Diese Regelung darf sich nicht nachteilig auf Freiversuch, Abschichtungsmöglichkeit oder Semesterhöchstfristen auswirken. Sie muss mindestens bis drei Monate nach der Wiedereröffnung der juristischen Bibliotheken im jeweiligen Land bestehen.
- Praktika: Studierenden, deren Praktika infolge des Coronavirus abgebrochen werden mussten, ist die Möglichkeit zuzugestehen, dieses zu einem späteren Zeitpunkt bei einer vergleichbaren Praktikumsstelle fortzuführen, soweit nicht ohnehin eine Anrechnung des vollständigen Praktikums erfolgt. Die landesrechtlichen Vorschriften zur Erbringung von Pflichtpraktika sind dahingehend zu modifizieren, dass ein infolge des Coronavirus nicht abgelegtes Praktikum einer Meldung für Schreibtermine bis zum 31. Dezember 2021 nicht entgegensteht. § 5a Abs. 3 Satz 2 DRiG ist dahingehend zu modifizieren, dass Praktika bis zum Ende des Wintersemesters 2021/22 auch in der Vorlesungszeit abgeleistet werden können.
- Freiversuch: Das Sommersemester 2020 ist für die Berechnung der Semesterzahl für Verbesserungsversuche, den Freiversuch und Abschichtungsmöglichkeiten unberücksichtigt zu lassen.
Optionsrecht für Prüfungen
Die Universitätsschließungen führen dazu, dass ein „normales“ Studium derzeit nicht möglich ist. Wo es allerdings an der Möglichkeit zu einer ungestörten Vorbereitung auf die Prüfung fehlt, ist auch eine vollen Leistungsfähigkeit in der Prüfung selbst unwahrscheinlich. Die Möglichkeiten, mit dem Wegfall des Lernplatzes zurechtzukommen, sind für jede*n Studierende*n unterschiedlich ausgeprägt. Zudem ist eine Prüfungsteilnahme – auch bei Einhaltung aller Abstandsregeln – stets mit einem nicht kontrollierbaren Infektionsrisiko verbunden. Zu ihrem eigenen Schutz sind Angehörige der Risikogruppen somit in allen Bundesländern von der Prüfung ausgeschlossen. Allerdings kann auch für Studierende, die nicht selbst der Risikogruppe angehören, eine unzumutbare Infektionsgefahr bestehen, insbesondere wenn etwa die eigenen Eltern, Geschwister oder Kinder der Risikogruppe angehören. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass diese Studierenden vor die Wahl zwischen ihrem Examen und der Gesundheit von ihnen und ihrer Familie gestellt werden.
Vor diesem Hintergrund haben etliche Prüfungsämter (z.B. das GJPA Berlin-Brandenburg, das JPA Hessen und die nordrhein-westfälischen Prüfungsämter) eine Regelung erlassen, die es Prüflingen ermöglicht, an mündlichen Prüfungen infolge der psychischen Belastung und gesundheitlicher Bedenken nicht teilzunehmen. In Nordrhein-Westfalen betrifft diese Regelung auch die – nur in diesem Bundesland stattfindenden – schriftlichen Klausuren für Mai. Ein Grund, warum es Prüflingen in anderen Bundesländern nicht möglich sein sollte, sich angesichts der außergewöhnlichen Umstände für einen späteren Prüfungstermin zu entscheiden, ist nicht ersichtlich. Folglich empfiehlt sich die flächendeckende Übernahme dieser Regelungen.
Hinsichtlich der Dauer der Freistellungsmöglichkeit halten wir eine mindestens dreimonatige Dauer, gerechnet ab der Öffnung der juristischen Bibliotheken im jeweiligen Land, für erforderlich. Diese ergibt sich daraus, dass die Öffnung der juristischen Bibliotheken nicht sofort den vollumfänglichen Zugang ermöglichen wird. Ferner bedarf es einiger Zeit, sich wieder an den Lernrhythmus zu gewöhnen, ehe die für die Prüfung notwendige Form erreicht und Rückstände aufgeholt werden können. Ferner dürfte die Öffnung der Universitäten in den ersten Wochen einen Anstieg der Infektionszahlen nach sich ziehen, sodass die Gesundheitssorgen zunächst zunehmen würden und eine Prüfung wegen der genannten Nähe zu Angehörigen der Risikogruppen den Prüflingen nicht zugemutet werden könnte. Jetzt schon eine Frist für die Wiederaufnahme der Prüfungspflicht festzusetzen, schafft Planungssicherheit für Studierende und Prüfungsämter. Die von uns vorgeschlagenen drei Monate sind dabei eine Mindestfrist, sodass auch längere Fristen unterstützenswert wären.
Praktika
Infolge des Ausbruchs der Pandemie mussten im März etliche Praktika abgebrochen werden und konnten nicht fortgesetzt werden. Die Regelungen der einzelnen Bundesländer über die Anerkennung von Praktika, die den Homepages der Prüfungsämter zu entnehmen sind, unterscheiden sich im Bundesvergleich sehr stark: In Bremen muss das Praktikum beim gleichen Praktikumsgeber für die Restzeit fortgesetzt werden, zudem sollen keine Lockerungen bei der dort vorgeschriebenen stufenweisen Aufteilung der Praktika gemacht werden. In Rheinland-Pfalz wird nur die tatsächlich geleistete Zeit angerechnet, dies auch nur, wenn sie mindestens drei Wochen beträgt. Andere Länder rechnen unabhängig von der Dauer die tatsächlich geleistete Zeit an (Bayern, in Nordrhein-Westfalen das Justizprüfungsamt Hamm) oder erlauben zumindest die Fortsetzung des Praktikums bei der gleichen Stelle (Niedersachsen). Baden-Württemberg, Berlin und Brandenburg erkennen abgebrochene Praktika grundsätzlich bis zu einer Dauer von vier Wochen an. Andere Bundesländer haben z.T. keine Regelungen zu Praktika auf der Homepage der Justizprüfungsämter veröffentlicht.
Alle veröffentlichenden Justizprüfungsämter signalisieren die vollumfänglich zu begrüßende Bereitschaft, ihre Härtefallregelungen bei einer Meldung für Klausuren im Herbst 2020 zur Anwendung zu bringen. Darüber hinaus führt der bundesweite „Flickenteppich“ allerdings dazu, dass Studierende trotz womöglich gleicher Praktikumsstellen und der gleichen Rahmenbedingung des § 5a Abs. 3 Satz 2 DRiG unterschiedlich behandelt werden. Ein Grund für diese Unterschiede ist nicht erkennbar.
Die offensichtlich zugrundeliegende Annahme, dass bei einer Prüfung im Jahr 2021 noch genügend Zeit zur Ableistung des Praktikums bestünde, beruht auf einem zweifachen Trugschluss. So können Praktika erstens nach geltender Rechtslage nur in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden, sollten in einem gut geplanten Studienverlauf aber vor dem Beginn der Examensvorbereitung abgeschlossen sein. Der Zeitpunkt der Praktika betrifft somit die langfristige Studienplanung und kann zumindest in fortgeschrittenen Semestern nicht mehr ohne Weiteres verschoben werden. Ist die Examensvorbereitung erst einmal begonnen, bringt die mehrwöchige Unterbrechung zur Ableistung eines Praktikums einen massiver Eingriff in die Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung mit sich. Die aktuellen Regelungen zwingen Studierende, diese Einschnitte in die Examensvorbereitung hinzunehmen oder deren Start und damit den Termin der Pflichtfachprüfung zu verschieben. Zweitens beruht sie auf der Annahme, dass ein geregelter Praktikumsbetrieb in den anstehenden vorlesungsfreien Zeiten möglich sei. Dies ist mitnichten der Fall: Durch die Verlegung oder Fortsetzung von im Frühjahr unterbrochenen Praktika in den Sommer/Herbst und die ungewisse Situation für Unternehmen, Kanzleien, Behörden und Gerichte ist selbst für zugesagte Praktika völlig unklar, ob diese stattfinden können. Neue Praktikumsplätze sind für die Studierenden aktuell kaum erhältlich. Für das Frühjahr 2021 ist nicht geklärt, wie sich die von der Kultusministerkonferenz angedachte Verschiebung des Semesterstarts auf den 1. November auf das Ende der Vorlesungszeit und damit die Zeitspanne für Praktika auswirkt. Eine verlässliche Praktikumsplanung für die kommenden zwei vorlesungsfreien Zeiten – und damit auch eine zeitliche Strukturierung der Examensvorbereitung – ist somit zum aktuellen Stand nicht möglich.
Praktische Studienzeiten stellen wichtige Elemente der Ausbildung dar und sollten nicht ersatzlos wegfallen, sondern vor dem Abschluss des Studiums durchgeführt werden. Ein striktes Festhalten an den aktuellen Regelungen hätte aber für viele Studierende massive Einschnitte in die Examensvorbereitung zur Folge, denen kein ausgleichender Mehrwert gegenübersteht. Der Ausbildungszweck der Praktika würde nicht signifikant leiden, würden sie nicht parallel zur zeitaufwändigen Examensvorbereitung, sondern stattdessen nach den schriftlichen Prüfungen abgeleistet. Um die im Jahr 2020 begonnene Examensvorbereitung nicht zu beeinträchtigen, ist daher eine Übergangsregelung anzustreben. In dieser sind Praktika nicht als bereits erfüllte Meldevoraussetzung für schriftliche Prüfungen zu verlangen, sondern als nachgelagerte Meldevoraussetzung auszugestalten. Somit müssten die Praktika zwar nicht vor den Klausuren, aber vor der mündlichen Prüfung oder Zeugniserteilung, abgeleistet sein. Ausgefallene Praktika könnten mithin auch noch unmittelbar nach der schriftlichen Examensprüfung nachgeholt werden. Dies gewährleistet die kohärente Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen und stellt gleichzeitig sicher, dass die praktischen Anteile des Studiums nicht gekürzt werden. Legt man eine Dauer der Examensvorbereitung von 12 – 18 Monaten zugrunde, so muss ein solcher Nachlass der Praktika als Meldevoraussetzung bis zum Schreibtermin 31. Dezember 2021 gelten, um in diesem Jahr mit der Examensvorbereitung beginnende Studierende nicht in ihrer langfristigen Studienplanung einzuschränken.
In Anbetracht der derzeitigen Ausnahmesituation und der Ungewissheit über die Dauer der vorlesungsfreien Zeit im kommenden Frühjahr sollte das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz sicherstellen, dass bereits für das Frühjahr 2021 geplante Praktika nicht durch eine Verlegung des Wintersemesters hinfällig werden. Hierzu sind Praktika in der Vorlesungszeit zumindest für eine gewisse Frist zuzulassen. Wird das Ende des Wintersemesters 2021/22 als Fristende gewählt, wäre sichergestellt, dass § 5a Abs. 3 Satz 2 DRiG der oben geforderten Möglichkeit zur Ablegung von Praktika unmittelbar nach den schriftlichen Prüfungen zu keinem Zeitpunkt entgegensteht.
Freiversuch
Präsenzlehre wird im gesamten Sommersemester 2020 vermutlich nicht mehr stattfinden. Auch wenn einige Facetten der Hochschullehre erfolgreich auf ein digitales Format umstellen konnten, wird das Sommersemester 2020 ein Semester mit massiven Einschränkungen. Dies liegt zum Teil in der Natur der Sache begründet: Es kann nicht gelingen, binnen weniger Wochen die Möglichkeiten zu schaffen, die bei der Umsetzung der Digitalisierung in den letzten Jahren unterlassen wurden. Eine derart kurzfristige Umstellung auf digitale Lehre ist ungeeignet, Präsenzvorlesungen gänzlich zu ersetzen. Vielmehr befindet sich die Hochschullandschaft durch die plötzliche Umstellung in einer neuen und einzigartigen Situation, auf die weder Hochschullehrende noch Studierende vorbereitet sind. Es fehlt auf beiden Seiten an technischem Wissen über die benutzten Programme und mitunter an der nötigen Hard- oder Software, sodass es im Lauf des Sommersemesters immer zu Einschränkungen mit negativen Effekten auf Studierende kommen wird. So können bereits einzelne fehlende Veranstaltungen das gesamte Studium ausbremsen.
Die Angebote an Lehr- und Lernplätzen an den Universitäten sind ebenso wie die Bibliotheken allenfalls eingeschränkt, vielerorts auch gar nicht nutzbar. Infolge dieser veränderten Rahmenbedingungen ist auch das Selbststudium im Sommersemester 2020 nur unter Ausnahmebedingungen möglich. Eine Ableistung von Seminararbeiten ohne vollen Quellenzugriff kann nur als Notlösung angesehen werden. Ein adäquates Erreichen der Lernziele ist somit nicht möglich, die Ausgestaltung von Prüfungen bislang ungeklärt. In den Lehrveranstaltungen und Prüfungen des Sommersemesters 2020 wird folglich weniger das juristische Wissen als die Möglichkeit zu Anpassung an die Krisensituation – die im Übrigen von den Studierenden nicht voll beeinflussbar ist – abgeprüft. Vor dem Hintergrund der Einschränkungen im Lernprozess, die letztlich jeden Studienabschnitt betreffen, ist bereits jetzt klar, dass die Ergebnisse des Sommersemesters 2020 nicht mit denen anderer Semester vergleichbar sein werden. Belässt man es demgegenüber bei einer regulären Anrechnung der Semesterzeiten, so würde dies in einem Vergleich resultieren.
Zu der Ausnahmesituation in der Lehre kommt die soziale Dimension: Viele Studierenden haben ihre Nebenjobs verloren und müssen nun – im besten Fall – ihren Lebensunterhalt anders als geplant und mit dem ursprünglichen Vorlesungsplan unvermeidbar erwirtschaften oder – im schlechtesten Fall – um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten. Für diese Studierenden ist an ein geregeltes Hochschulstudium nicht zu denken. Diese Einschränkungen treffen besonders die Schwächsten der Gesellschaft, sodass die Abhängigkeit von Elternhaus und Studienerfolg zunehmen dürfte.
Unter Berücksichtigung aller Umstände hat sich die Kultusministerkonferenz dafür ausgesprochen, dass Studierende, „die keine oder nicht alle vorgesehenen Leistungen aufgrund der Folgen der Covid-19-Pandemie und dem damit eingeschränkten Lehrangebot erbringen können, (…) grundsätzlich keine Nachteile hinsichtlich Regelungen, welche zum Beispiel die Regelstudienzeiten aufgreifen, erfahren“ sollen. Im Rahmen des BAföG sowie der Krankenversicherung und weiterer Bereiche wird folgerichtig eine Anpassung von Fristen oder Semestergrenzen vorgenommen, um Studierende mit den Einschränkungen des Sommersemesters nicht allein zu lassen. Die dafürsprechenden Argumente lassen sich auf die Fristen zum Verbesserungsversuch, zum Freiversuch und zur Abschichtungsmöglichkeit übertragen. So besteht auch im juristischen Studium eine bloß eingeschränkte Lernmöglichkeit und die Fakultäten befinden sich faktisch in einer experimentellen Phase.
Die von der KMK beabsichtigte Nachteilsvermeidung wäre folglich im juristischen Studium unvollständig, wenn sie nicht auf Verbesserungsversuch, Freiversuch und Abschichtung übertragen würde. Die flächendeckenden und vielschichtigen Einschränkungen im Studium werden über die bestehenden Härtefallklauseln mit ihrer gebotenen aufwändigen Einzelfallabwägung nur unzureichend erfasst. Vor diesem Hintergrund haben die Justizprüfungsämter in Bayern, Hessen und Thüringen bereits angekündigt, das Sommersemester 2020 nicht auf Freiversuchsfristen anzurechnen. Auch in den anderen Bundesländern bedarf es einer entsprechenden Regelung, um dem bundesweiten Charakter der Pandemie Rechnung zu tragen und die fehlende Vergleichbarkeit des Sommersemesters 2020 zu anderen Semestern sowie die Gedanken der Kultusministerkonferenz zu berücksichtigen.