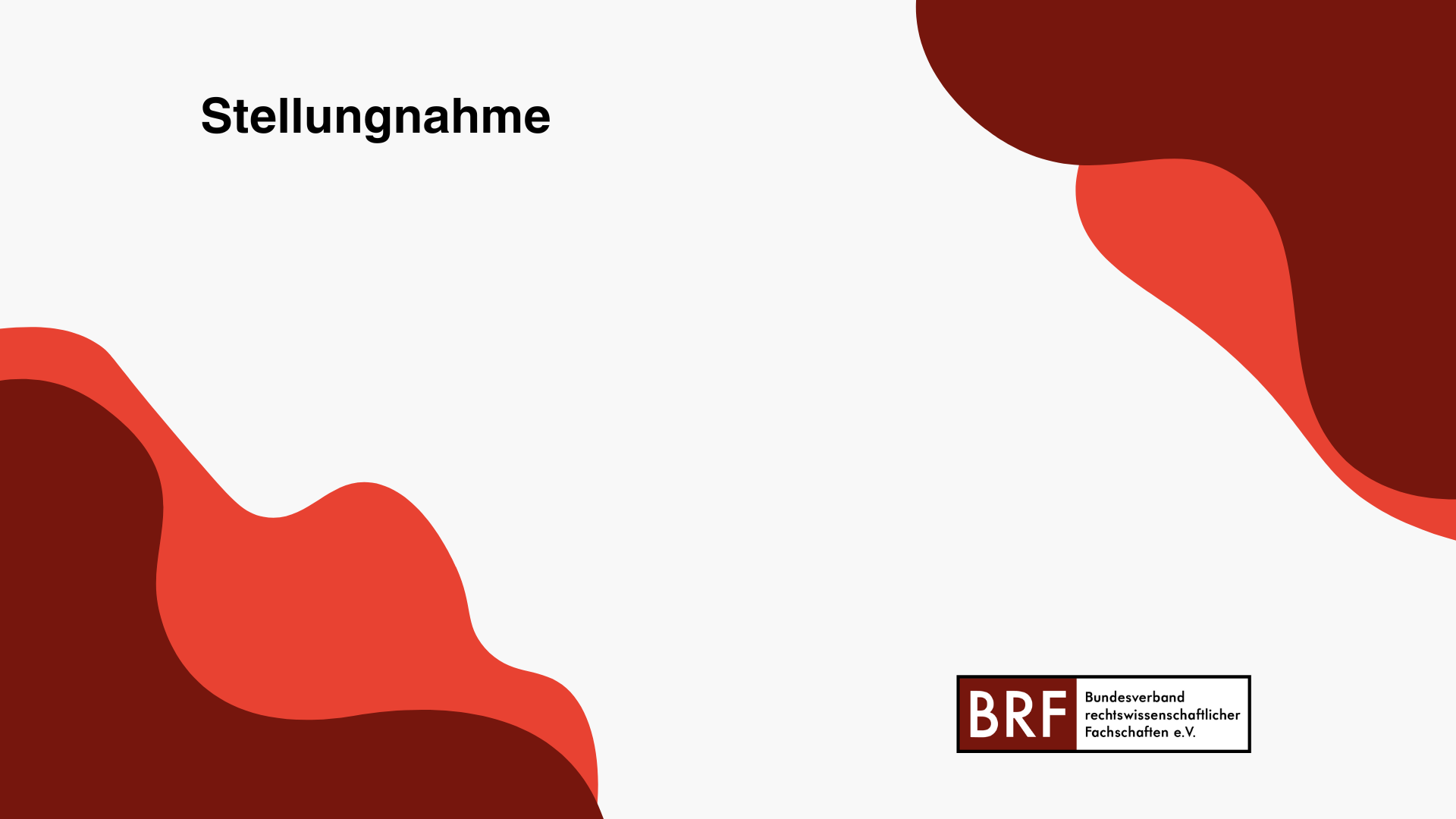05. März 2023
Der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (BRF) freut sich eine umfassende Stellungnahme zu den Ergebnissen der iur.Reform-Umfrage abgeben zu können. Wir sind insbesondere den Initiator:innen sehr dankbar für die Idee, die Ausarbeitung, die Durchführung und die wirklich hervorragende Vernetzung mit anderen Stakeholdern und Verbreitung der Initiative. Wir sind überzeugt, dass die juristische Ausbildung eine umfassende Reform benötigt. Iur.Reform hat die dazu nötige Aufmerksamkeit geschaffen und viele Beteiligte und Interessierte für dieses so wichtige Thema innerhalb der Rechts- und Justizpolitik sensibilisiert. Wir erhoffen uns neuen Schwung für die Reformdebatte und werden ebenso – auch anhand der Ergebnisse dieser Umfrage – im Sommer ein eigenes studentisches Reformkonzept vorstellen. Wir freuen uns auf eine fruchtbare und konstruktive Debatte im Sinne aller Jurastudierenden in Deutschland.
Der BRF ist die offizielle Vertretung der über 110.000 Jurastudierenden in Deutschland und repräsentiert deren Interessen überparteilich gegenüber Politik, den Universitäten, den JPAs und allen anderen Stakeholdern. Mitglieder des BRF sind die 43 Fachschaften der juristischen Fakultäten in Deutschland, welche so eine demokratische Legitimation gewährleisten. Mit unserer Stellungnahme möchten wir eine studentische Perspektive auf die Umfrage werfen und herausstellen, was der jungen Generation – dem juristischen Nachwuchs – besonders wichtig ist.
Zunächst ist erfreulicherweise festzustellen, dass neben über 5000 Studierende, auch über 1600 Referendar:innen teilgenommen haben. Dies zeigt, dass es gerade die Menschen, die sich in der juristischen Ausbildung befinden, bewegt, wie sich Studium und Referendariat in Zukunft weiterentwickeln. Gleichzeitig beweist die hohe Teilnahme und die Involvierung von Studierenden den Reformbedarf der juristischen Ausbildung.
Block 1: Die 16 meistdiskutierten Thesen
Die Hauptreformthesen des ersten Blocks spiegeln die geltende Beschlusslage des BRF in unserem Grundsatzprogramm weitestgehend wider. Im Zentrum unserer Anstrengungen einer zeitgemäßen und attraktiven juristischen Ausbildung stehen die Reduktion von psychischem Druck, die Möglichkeit der Profil- und Charakterbildung für Studierende und ein Kulturwandel im Jurastudium: Weg vom Gegeneinander und der Ellenbogenmentalität unter Studierenden, befeuert von den Strukturen, hin zu einem Miteinander und der Wertschätzung von Zusammenarbeit und Teamfähigkeit. Besonders auffallend in der Umfrage ist der Unterschied im Abstimmungsverhalten zwischen männlichen auf der einen, und weiblichen und diversen Personen auf der anderen Seite. Dies zeigt eindeutig, dass die juristische Ausbildung in großen Teilen noch den Strukturen und Denkmustern der juristischen Ausbildung des deutschen Kaiserreichs entspricht: Ein Studium von Männern für Männer. Hier ist anzusetzen: Gerade angesichts des sich immer weiter vertiefenden Jurist:innenmangels ist es unerlässlich, die juristische Ausbildung für alle gesellschaftlichen Gruppen attraktiv zu gestalten, bevor der mangelnde Nachwuchs zu einer Bedrohung für die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats wird. Dazu gehört es anzuerkennen, dass der Staatsdienst, auf den das Staatsexamen ausgerichtet ist, nicht mehr die Regel ist und dass sich die Anforderungen des modernen juristischen Arbeitsmarktes geändert haben. Das juristische Studium muss daher aus unserer Sicht viel mehr Raum für Spezialisierung und Internationalisierung lassen, sodass die Jurist:innen von morgen den Problemstellungen und Krisen unserer globalisierten und hochspezialisierten Welt gerecht werden können.
Zu 1a: Allgemeine Zufriedenheit
Die absolute Mehrheit ist unzufrieden mit dem aktuellen Stand der juristischen Ausbildung. Nur knapp 20 % sind grundsätzlich zufrieden und das unter allen Altersgruppen. Dies beweist ganz eindeutig, dass sich etwas ändern muss: Weder spricht das Jurastudium die jungen Menschen an, die es gerade durchlaufen oder für die es nur wenige Jahre zurückliegt, noch reißt es die älteren Jurist:innen dazu hin, sich übermäßig positiv zu ihren Ausbildungserfahrungen zu äußern. Die Unzufriedenheit besteht gleichfalls unabhängig von der Notenstufe im Examen oder dem Studienort.
Wir haben ein großes Problem: Unser Studium und die juristische Ausbildung insgesamt sind nicht attraktiv und wir als angehende und praktizierende Jurist:innen können angesichts unserer Unzufriedenheit nicht einmal ernsthaft positiv Werbung für das Jurastudium machen. Dies ist angesichts des Jurist:innenmangels, der sich immer weiter verstärkt, inakzeptabel. Daher muss das Jurastudium umfassend reformiert werden. Dass gerade die Studierenden und die Referendar:innen so unzufrieden sind, verdeutlicht, dass sich unbedingt etwas ändern muss, um gegenüber potentiellen Studieninteressent:innen attraktiv und überzeugend sein.
Wir im BRF sehen in unserer Arbeit und in unseren Gesprächen die Bereitschaft bei vielen Stakeholdern zu ernsthaften und verbindlichen Reformgesprächen, wenn man alle erstmal an einen Tisch bringen würde. Iur.Reform bietet somit die optimale Plattform anhand der Ergebnisse in diese Debatten zu treten. Wir, als Vertretung der Jurastudierenden in Deutschland, laden alle ein, gemeinsam zu diskutieren und eine Reform umzusetzen. Wir möchten in dieser Hinsicht vor allem an die Professor:innen und die JPAs appellieren, bei denen die Unzufriedenheit noch am geringsten ist, offen zu sein für die Realitäten vieler Studierender und Bereitschaft zu zeigen, Kompromisse einzugehen. Ziel für uns alle sollte sein, dass das Jurastudium wieder eine attraktive Ausbildungslaufbahn darstellt und wir viele junge Menschen für dieses – eigentlich so schöne – Studium begeistern können. Nichts mehr als die Funktionsfähigkeit unseres Rechtsstaates hängt davon ab.
Zu 1b: Integrierter Bachelor
Die aktuell am meisten diskutierte Forderung gilt für den BRF als Indikator für Reformbedürftigkeit der juristischen Ausbildung und war Inhalt zahlreicher Artikel und Diskussionen im letzten Jahr. Die Forderung nach dem integrierten Bachelor ist sowohl Teil der Beschlusslage des BRF (§ 3 Grundsatzprogramm) und des im Jahr 2021 vorgelegten 5-Punkte-Plan zur Reduzierung des psychischen Drucks. Das Abstimmungsergebnis der iur.Reform-Umfrage bestärkt die Positionen der Studierendenschaft. Eine absolute Mehrheit spricht sich für den Bachelor aus, eine große Mehrheit steht auch über die Statusgruppe der Studierenden hinaus hinter der Reformthese. Dass sich insgesamt nur 19% der Befragten dagegen aussprechen, zeigt, wie verzehrt die Debatte in der Öffentlichkeit geführt wird. Letztlich sprechen sich nur die JPAs mehrheitlich gegen die Einführung aus, was aber aus deren Sicht als “Hüter” des Staatsexamens nur logisch und der Rolle entsprechend erscheint. Unsere Position ist dadurch in jedem Fall gestärkt: Ein starkes Bedürfnis unter Betroffenen ist nachgewiesen. Außerdem verdeutlicht der Unterschied in der Beurteilung zwischen den Altersgruppen und der abfallenden Zustimmung, je weiter die Ausbildung weg liegt, dass die Bedingungen heutzutage offenbar andere sind als früher. Spannend ist aus unserer Sicht insbesondere, dass Menschen, die im Ausland studiert haben, der Forderung wohl besonders zugetan sind. Auch dies unterstreicht die Notwendigkeit der Einführung des integrierten LL.B. bezüglich einer stärkeren Internationalisierung des Jurastudiums. Fast alle Berufsgruppe, außer Richter:innen und JPAs.
Zu 1c: Einstufige juristische Ausbildung (Loccum)
Eine umfassende Reform der juristischen Ausbildung erscheint uns als unausweichlich. In welchem Rahmen dies geschieht und in welchem Umfang steht für uns noch nicht fest. Wir werden uns gerne an Gesprächen dazu beteiligen und in unserem von einer Arbeitsgruppe ausgearbeiteten Reformvorschlag auch auf die einstufige Juristenausbildung eingehen. Die Studienergebnisse zeigen, dass eine grundsätzliche Bereitschaft zu diesen Gesprächen und Diskussionen besteht. Dass die Zustimmung nicht ganz so groß ist wie beim Bachelor, beweist aus unserer Sicht, wie schwer es für viele ist, sich neben den bestehen Studienmodellen andere Alternativen vorzustellen, insbesondere unter den Studierenden, die die ersten Versuche des Loccums nicht miterlebt haben. Wir fordern daher, dass die Reformdiskussionen unbedingt solche Alternativen wie das Loccum miterörtern und in die Willensbildung -einbeziehen.
Zu 1d + 1e: Reduzierung des Prüfungsstoffs
Die Reduzierung des Prüfungsstoffes in der ersten juristischen Staatsprüfung (These 1.d.) ist bereits eine nachhaltige Forderung des BRF. Nach unserer Ansicht lässt eine geringere Stoffdichte eine methodischere Auseinandersetzung mit den juristischen Fragestellungen zu. Wir sehen unsere Forderung nach der Reduzierung des Prüfungsstoffes durch die Antworten der Befragten gestützt, da 67,1 % dieser These mit Zustimmung begegnet sind. Dieses Ergebnis lässt sich auch auf die hohe Zustimmung Referendar:innen, Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen und Promovierenden zurückführen, welche am jüngsten Erfahrung mit der hohen Stoffdichte gemacht haben.
Auf die Frage, in welchen Fächern der Stoff reduziert werden soll (These 1.e.), forderten die meisten Befragten eine anteilige Reduzierung, wobei auch eine Reduzierung in den zivilrechtliche Nebenfächern, dem Völkerrecht und den Grundlagenfächern gefordert wurde. Der BRF fordert hierbei eine allumfassende kritische Reflexion des Prüfungsstoffs, wobei auch eine bundesweite Harmonisierung des Prüfungsstoffes angestrebt werden sollte. Zudem vertreten wir die Auffassung, dass die übermäßige Abfrage von Inhalten aus den Bereichen der Grundlagenfächer nicht zielführend ist. (vgl. § 30 Grundsatzprogramm)
Zu 1f: Legal Tech
Der hohen Zustimmung zur Implementierung von Legal Tech in der juristischen Ausbildung schließt der BRF sich an. Die juristische Ausbildung befindet sich nicht im luftleeren Raum, sondern muss sich mit den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Fragestellungen befassen. Dies haben die Lehrinhalte der Hochschule zu berücksichtigen. In § 28 des Grundsatzprogramms fordern wir, dass die Fakultäten Lehrveranstaltungen, Seminare oder Schlüsselqualifikationskurse zu Legal Tech und Rechtsfragen der Digitalisierung anbieten. Diese Thematiken sollen weiterhin, wenn passend, in bestehende Lehrveranstaltungen einbezogen werden. Schließlich soll jede Fakultät eine:n wissentschaftliche:n Beauftragte:n für Legal Tech in der Lehre benennen. Das steigert die Attraktivität der juristischen Ausbildung und sorgt für zeitgemäße Lehrinhalte und -methoden.
Zu 1g: Methoden der Sozialwissenschaften
Auch dieser Forderung schließt sich der BRF an. Eine vertiefte Interdisziplinarität ist aus unserer Sicht unerlässlich im Jurastudium, insbesondere in den Grundlagenfächern und den Schwerpunktbereichen. (vgl. § 27 des Grundsatzprogramms) Dass sich hier vor allem die Methoden der Sozialwissenschaften anbieten liegt auf der Hand: Studierende der Rechtswissenschaften sollen sich mit den Erscheinungs- und Verwirklichungsformen des Rechts im sozialen Leben auseinandersetzen, gerade auch um das Recht und seine Strukturen kritisch reflektieren zu können. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus der gesetzlichen Verpflichtung des § 5a DRiG, nach der alle Studierenden diese Fähigkeiten auch durch den historischen Vergleich zum NS-Unrecht erlernen sollen. Durch die Zustimmung der Mehrheit der Befragten fühlen wir uns in unseren diesbezüglichen Forderungen in § 27a des Grundsatzprogramms gestärkt.
Zu 1h: Mediation
Der praktische und berufsvorbereitende Kompetenzerwerb, beispielsweise der Mediation, sind essentiell in der juristischen Ausbildung und sollten eher gestärkt werden – verbunden mit einer Reduzierung des Pflichtfachstoffs. Fakultäten können Schlüsselqualifikationen bzw. Seminare zu Rhetorik und Mediation anbieten und Studierende umfassend über die verschiedenen Berufswege und -anforderungen informieren. Dies würde dazu führen, dass Studierende sowohl bereits Kenntnisse mit in die Praxis nehmen, als auch wissen, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen und wie sie ihre Ziele erreichen können. Auch hier freuen wir uns über die Zustimmung der Befragten und hoffen auf eine zielführende Umsetzung.
Zu 1i: Schwerpunktstudium (Abschaffung)
Wenige Debatten wurden in der jüngeren Ausbildungs- und Reformgeschichte umfassender geführt als die um den Schwerpunkt. Diese Diskussion ist aber schlussendlich eben auch ausdiskutiert. Der BRF spricht sich in § 37 des Grundsatzprogramms jedenfalls ganz eindeutig für den Erhalt des Schwerpunktbereichs aus. Besonders unter Personen, die den Schwerpunkt absolviert haben, zeigt sich, dass dieser hervorragend angenommen wird. Er ist eine beliebte Reform, die viel Raum zur individuellen Entfaltung und Spezialisierung bietet. Statt also über eine Abschaffung zu diskutieren und sich damit einzugestehen, dass man kein Vertrauen in die Qualitätskontrolle der Universitäten hat, sollte man an einer guten Vergleichbarkeit der Schwerpunkte arbeiten. Darüber hinaus können sich Überlegungen anschließen, inwieweit eine weitere Spezialisierung und Vertiefung mit in das Studium integriert werden können.
Zu 1j: Abschichten (bundesweit)
Das Abschichten zeigt sich seit längerem als erfolgreiches Mittel zur Reduktion von psychischem Druck und der Angst vor dem Examen und so haben wir dieses bereits zur vergangenen Bundestagswahl in unserem 5Punkte-Plan zur Reduktion des psychischen Drucks gefordert. (ebenso in unserem Grundsatzprogramm in § 32 Abs. 3). Wir unterstützen dementsprechend die Forderung, das Abschichten bundesweit (wieder-) einzuführen, statt diese Möglichkeit aus finanziellen Gründen immer weiter abzubauen. Es zeigt sich, dass die Zustimmung nicht nur unter Jurastudierenden hoch ist, sondern sich durch alle Altersschichten zieht; verständlich, zumal das Abschichten besonders auch für Berufstätige das Bestreiten des Examens erleichtert und für eine Vereinbarkeit von Studium und Familie sorgt.
Zu 1k: E-Examen
Bereits eine absolute Mehrheit (53,2 %) stimmten der Forderung nach der bundesweiten Einführung des EExamens (These 1.k.) vollständig zu. Der BRF steht schon länger hinter dieser Forderung und sieht sich besonders durch hier in seiner Ansicht durch die Studierenden, aber auch alle anderen Berufsfelder bestätigt. So findet sich sogar bei den Angestellten der Justizprüfungsämter, welche schlussendlich mit der Aufgabe der Umsetzung betraut sind, eine generelle Zustimmung zu diesem Thema. Bei dieser großen Zustimmung stellt sich für uns somit nicht mehr die Frage, ob das E-Examen kommen sollte, sondern unter welchen Modalitäten die Einführung in den beiden staatlichen Pflichtfachprüfungen ausgestaltet wird. Hier könnten zwischen den verschiedenen Gruppen Meinungsverschiedenheiten bestehen, welche größerer Beachtung bedürfen.
Zu 1l + 1m: Online-Datenbanken + Handkommentare
Die Zulassung von Online-Datenbanken (These 1.l.), bzw. Handkommentaren (1.m.) in der ersten juristischen Staatsprüfung wird von den Befragten unterschiedlich bewertet. Während eine Mehrheit von 59,8 % die Zulassung von Handkommentaren befürwortet, scheitert die Zulassung von Online-Datenbanken knapp. Der BRF befürwortet beide Hilfsmittelformen und fordert die Gleichbehandlung bei der Zulassung, um in Verbindung mit dem E-Examen auch vollständig digitale Prüfungen zu ermöglichen. (vgl. §§ 22, 26 Grundsatzprogramm) Als Grund für die Zulassung spricht, dass beide, sowie andere, Hilfsmittel wird in Prüfungssituationen praxisnahes juristisches Arbeiten vermitteln. Wichtig bei der Zulassung ist jedoch diese Hilfsmittel, wie auch andere Hilfsmittel, bundesweit einheitlich für die Prüfungen zugelassen werden, da nur so eine Vergleichbarkeit zwischen den Ländern hergestellt werden kann.
Zu 1n: Unabhängige Bewertung
Die These, dass Korrektor:innen ihre Bewertung einer Klausur ohne Kenntnis und unabhängig von anderen Korrektor:innen anfertigen sollen (These 1.n.) findet insgesamt beeindruckende 87,4 % Zustimmung (Absolute Zustimmung 72,9 %). Die Gefahr, dass die Zweitkorrektur durch die Bewertung der Erstkorrektur beeinflusst werden kann, sieht auch der BRF, weshalb er bereits 2020 gemeinsam mit dem DAV die Abschaffung dieser Praxis gefordert hat.
Zu 1p: Emotionale Entlastung
Dass der Psychische Druck in der juristischen Ausbildung immer mehr und mehr Studierende betrifft und belastet, ist kein Geheimnis mehr. Dies zeigt nicht zuletzt die Umfrage des psychischen Drucks des BRF aus dem Jahr 2021 oder die Iurstress-Studie aus Regensburg3. Die hohe Zustimmung zur Erforderlichkeit der Reduzierung der emotionalen Belastung unterstreicht, wie sehr die juristische Ausbildung einen Kultur- bzw. Mentalitätswandel benötigt. Mehr Zustimmung kommt auch hier gerade bei Frauen: Gerade aus einer feministischen Perspektive kann dieser Zustand der juristischen Ausbildung so nicht hingenommen werden. Doch stellen viele der getroffenen und angedachten Lösungen, inklusive des integrierten Bachelors, nur eine Symptombekämpfung dar, viel mehr bedarf es zur Bekämpfung psychischen Belastung aus unserer Sicht eine umfassende Reform der Ausbildung, die sowohl an der Stoffmenge wie auch an den Methoden ansetzt.
Block 2: Ausbildungsausrichtung
Im zweiten Block der Befragung werden insbesondere die Meinungen zum Thema der Ausbildungsausrichtung abgefragt. Gerade in diesem Block zeigt sich, wie sich die Bedarfe und Ansprüche von Studierenden, Referendar:innen und Praxis innerhalb der juristischen Ausbildung darstellen. Dabei wird deutlich, dass ein starker Wunsch nach Internationalisierung, der Anerkennung von Studienleistungen vor dem Staatsexamen, sowie, besonders bei Frauen, nach Flexibilisierung herrscht.
Trotzdem spricht sich in These 2.a eine klare Mehrheit gegen eine Umstellung auf das Bologna-System aus, auch innerhalb der jüngeren Altersgruppen und der Studierendenschaft. Dies entspricht ebenfalls der Haltung des BRF. Uns als Studierenden ist es ebenfalls wichtig, das Staatsexamen als Abschluss des Studiums bzw. der Ausbildung zu erhalten, um so den besonderen Status der juristischen Ausbildung zu gewährleisten. Die größere Offenheit bei jüngeren Jurist:innen und vor allem Frauen pro Bologna verdeutlicht allerdings erneut die Reformbedürftigkeit der Ausbildung. Gerade der juristische Nachwuchs ist es, der sich bereit zeigt für Reformen innerhalb des Staatsexamenssystems. Dazu dürfen gerne Elemente des Bologna-Systems übernommen werden wie der integrierte Bachelor, eine verstärkte Flexibilisierung und Internationalisierung, sowie die Möglichkeit, die bereits vor dem Staatsexamen erbrachten Leistungen miteinzubringen. Dennoch ist die Staatsprüfung für uns einer der Qualitätsgaranten der juristischen Ausbildung. Sie sorgt für eine Vergleichbarkeit und vor allem eine Gleichwertigkeit der Abschlüsse. Dies heißt aber nicht, dass es keiner Reformen bedarf – ganz im Gegenteil.
Dies umfasst gleichfalls die in These 2.b gestellte Forderung eines Master-Abschluss für den Schwerpunkt. Diesem Ziel möchten wir uns angesichts immer weiter zunehmender Internationalisierung und Globalisierung anschließen. Das Studium würde so an das ECTS-System angeschlossen und böte zahlreiche Anknüpfungsmöglichkeiten im Ausland weiterzustudieren. Außerdem würde das von vielen nachgefragte Angebot einer vertieften Spezialisierung dadurch aufgewertet und gefördert. Studienleistungen würden so auch deutlich besser anerkannt. Dass besonders diejenigen, die im Ausland studiert haben, für diese These gestimmt haben (> 75 %) muss uns bewusst machen, dass wir langfristig durch Maßnahmen wie die Vergabe eines Masterabschlusses für den Schwerpunkt die Attraktivität von Deutschland als Jura-Ausbildungsstandort garantieren müssen.
Bezüglich einer verstärkten Laufbahnorientierung ergeben sich differenziertere Ergebnisse (vgl. These 2c). Dennoch ist sichtbar, dass sich ein beträchtlicher Teil der Befragten eine stärkere Spezialisierung wünscht Auch hier zeigt sich, dass dieser Bedarf nach Flexibilisierung und Selbstbestimmung bei Frauen offenbar noch deutlich höher, ist, als bei Männern. Der BRF spricht sich grundsätzlich in § 1 seines Grundsatzprogramms für den Erhalt der juristischen Ausbildung als volljuristische Ausbildung aus. Dennoch müssen in diesem Rahmen eine gewissen Laufbahnorientierung und Profilierung der Studierenden möglich sein, um den vielfältigen Interessen und Motivationen gerecht zu werden. Dazu zählen uns qualitativ hochwertige und anerkannte Schwerpunktbereiche, interdisziplinäre und praxisbezogene Studieninhalte und Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung zu jedem Zeitpunkt der Ausbildung. Diesem Anspruch wird das Studium aktuell nicht gerecht.
Gleiches gilt für die Mitberücksichtigung von Leistungen im Studium in der Examensnote, welche in These 2.d abgefragt wird. So könnten bislang nicht honorierte Studienleistungen anerkannt werden. Die hohe Zustimmung unter den Teilnehmenden zeigt den Bedarf einer solchen entlastenden Regel, die die Wichtig- und Ausschließlichkeit der (wenigen) Prüfungstage am Ende des Studiums reduzieren würde. Das könnte zu mehr Fairness im Studium führen, da nun Leistungen über einen größeren Zeitraum abgefragt werden und Noten nicht ausschließlich von Tagesformen abhängen würden. Eine genaue Umsetzung dieser These bleibt zu diskutieren. Dass einmal mehr die Zustimmung bei weiblichen Personen deutlich höher ist als bei Männern zeigt erneut, dass das aktuelle System gerade Männern eher entgegenkommt als nicht-männlichen Personen.
Schließlich wird in These 2.e gefragt, ob der Freischuss abgeschafft werden soll. Die hohe Ablehnung (> 70 %) über alle Altersklassen und Berufsgruppen hinweg bestätigt unsere langjährigen Forderungen nach dem Erhalt des Freischusses, gerade auch deswegen, um den psychischen Druck zu minimieren (vgl. § 35 Grundsatzprogramm). Anstatt einer Abschaffung, sollte es viel eher bundesweit vereinheitlicht werden, dass allen Studierenden mindestens die Möglichkeit auf einen Freischuss- und einen Verbesserungsversuch zugestanden wird, was wir gleichfalls im Fünf-Punkte-Plan einforderten.
Block 3: Inhalte der Ersten juristischen Staatsprüfung
Die Fragen, ob Prozessrecht (These 3.a.) und Europarecht (These 3.b.) eine größere Rolle im Stoff der ersten juristischen Staatsprüfung spielen soll wurde von den meisten Befragten mit Ablehnung begegnet. Auch wenn die Praxisnähe und Internationalisierung durch diese Maßnahmen gestärkt werden würden schließt sich der BRF hier dieser ablehnenden Mehrheit an. Eine weitere Überfrachtung mit Stoff in der ersten juristischen Staatsprüfung wird, wie sich auch in These 1.d. gezeigt, weder von einer Mehrheit gefordert noch ist sie unserer Meinung nach förderlich für die juristische Ausbildung als solches.
In der ersten juristischen Staatsprüfung werden, mit Ausnahme von einigen Bundesländern, sechs Klausuren geschrieben. Auf die Frage, ob diese Anzahl erhöht werden soll, wurde durch die Befragten mit stärkerer Ablehnung begegnet (These 3.c.). Diese lässt sich auch in den verschiedenen Gruppen, bzw Verhältnissen zur juristischen Ausbildung beobachten. Wir sehen sich durch dieses Ergebnis grundsätzlich in unserer Position bestätigt. Jedoch fordern wir weiterhin, dass die Anzahl der Klausuren in allen Bundesländern einheitlich sechs beträgt, da dies für eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern herstellt.
In der Frage des Umfangs der Klausuren der ersten juristischen Staatsprüfung (These 3.d.) stimmte eine Mehrheit der Befragten für die Reduzierung des Prüfungsstoffes pro Klausur. Dieses Ergebnis hat sich in Teilen bereits durch die These 1.d. gezeigt, weshalb auch für der Reduzierung in den Klausuren zustimmen. Unserer Meinung nach kann so in den Klausuren eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Prüfungsstoff geschehen und dadurch den Prüfungsstress durch reine Zeitnot reduzieren.
Bei Wiedereinführung der Examenshausarbeit (These 3.e.) zeigt sich bei den Befragten kein klares Meinungsbild, wobei jedoch eine kleine Mehrheit für die Wiedereinführung ausspricht. Der BRF spricht sich jedoch gegen diese Maßnahme aus. Die Wiedereinführung würde zum weiteren Ausbau der ersten juristischen Staatsprüfung führen und könnte der psychische Druck während der Examensphase ins Unermessliche gesteigert werden. Weiter werden die durch häusliche Arbeiten erlangten juristischen Kompetenzen, wie zB wissenschaftliches Arbeiten, unserer Meinung nach bereits ausreichend durch die Hausarbeiten, sowie Seminararbeiten gelernt und abgefragt.
Die Herstellung einer Kongruenz zwischen Studiumsinhalten und der ersten juristischen Staatsprüfung (These 3.f.) wird von den aller meisten Befragten befürwortet. Besonders auffällig ist in diesem Bereich, dass nur 6,7 % der Befragten dieser These mit Ablehnung begegnen. Der BRF schließt sich hierbei der deutlichen Mehrheit an.
Die diversere Aufstellung der Prüfungskommissionen in der mündlichen Prüfung (These 3.g.) wird durch eine 60,3 %-Mehrheit gegen eine 15,5 %-Minderheit unterstützt. Bereits 2020 hat der BRF gemeinsam mit dem DAV für die Paritätische Besetzung von Prüfungskommissionen gefordert. In der Auswertung fällt jedoch auf, dass die Ablehnung einer diverseren Besetzung der Prüfungskommissionen bei nicht-weiblichen Befragten deutlich höher ist, als dies bei weiblichen Befragten der Fall ist. Wir möchten deshalb hier noch einmal für diese Forderung werben. So zeigte, bspw. eine Studie in Nordrhein-Westfalen, dass es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern in der Benotung der mündlichen Prüfung des zweiten Staatsexamens bei rein männlich besetzten Prüfungskommissionen gibt. Diese Diskrepanz verringerte sich jedoch, sobald mindestens eine weibliche Prüferin Teil der Prüfungskommission war.5 Weiter lassen sich positive Effekte auf die Prüfungssituation durch Rollenmodelle erahnen.
Block 4: Organisation des Studiums
Zu 4a: Änderung des Notenstufensystems
Es wurde die These aufgestellt, dass das juristische Notensystem verändert werden sollte. Mit 61,9 % allgemeiner Zustimmung unter den Studierenden und 15,9 % neutralen Stimmen wird der Wunsch nach einer Reform deutlich.
Der BRF hat sich hierzu in den vergangenen Jahren in § 18 III des Grundsatzprogrammes geäußert: „An dem 18-Punkte-System kann grundsätzlich festgehalten werden, jedoch müssen die Anforderungen an die einzelnen Punktzahlen detailliert definiert und transparenter dargestellt werden. 2Zudem muss eine einheitliche und faire Umrechnungstabelle eingeführt werden, die eine Anrechnung der Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen erlaubt.“.
Maßgebend für die Studierendenschaft ist ein Notensystem welches transparent und fair gestaltet ist. Es muss nachvollziehbar sein, wie eine Bewertung zustande kam und den Studierenden einen Mehrwert für zukünftige Prüfungsleistungen bieten. Für eine Reform ist ebenso zu beachten, dass eine Umrechnung von Prüfungsleistung in andere Notensysteme ermöglicht wird, um insbesondere der zunehmenden Internationalisierung des Jurastudiums Rechnung zu tragen, aber auch Studiengangswechselnden einen reibungslosen Wechsel zu ermöglichen.
Zu 4b: Regelstudienzeit = Durchschnittsstudiendauer
Bezüglich der Regelstudienzeit wurde die These aufgestellt, dass diese an die Durchschnittstudienzeit angepasst werden sollte. Mit einer allgemeinen Zustimmung von 71 % der gesamten Studienteilnehmenden und einer Quote von 80,9 % unter den Studierendenden, ist der Reformbedarf sehr deutlich sichtbar.
Insbesondere aus Sicht der Studienfinanzierung ist die Anpassung der Regelstudienzeit an die tatsächliche Durchschnittsstudiendauer sinnvoll. Das BAföG orientiert sich bei der Förderungshöchstdauer an der Regelstudienzeit. In vielen Fällen endet diese im letzten Abschnitt des Studiums und stellt die ohnehin psychisch belasteten Studierenden vor eine weitere Hürde. Ein finanziell abgesichertes Studium mindert den psychischen Druck und ermöglicht ein Studium im Sinne der Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit.
Zu 4c: Ausgestaltung der Zwischenprüfung
Die These „Die Zwischenprüfung sollte umfangreicher sein und den Stoff der Ersten juristischen Staatsprüfung umfassender abdecken.“, wurde nicht eindeutig beantwortet. Mit jeweils 1/3 der Stimmen wurden sowohl Zustimmung, Neutralität und Ablehnung ausgedrückt.
Für eine mögliche Reformierung der Zwischenprüfung, müsste die generelle Ausgestaltung des Prüfungsstoffes8 betrachtet und anhand dessen eine Neuausrichtung durch sinnvolle Ergänzungen bzw. Reduzierungen angegangen werden. Grundsätzlich sollte eine Harmonisierung der Prüfungsinhalte in allen Bundesländern angestrebt werden und die juristische Methodenlehre der reinen Wissensvermittlung vorgezogen werden, iSd. § 30 GP.
Zu 4d: Betreuungsschlüssel
Bezogen auf die These, dass es einer engeren Betreuung der Studierenden bedarf, gab es eine generelle Zustimmung von 68,2 % und eine generelle Ablehnung von lediglich 9,3% der Stimmen. Auch von Seiten der Studierenden gaben 71 % ihre generelle Zustimmung.
Eine Intensive Betreuung und Hilfestellung im Studium kann einem erfolgreichen Studium nur zuträglich sein, weswegen sowohl Dozierende als auch Studierende in Bezug auf den Betreuungsschlüsse Reformen begrüßen.
Zu 4e: Zulassung anderer Prüfungs-/Unterrichtsformen
Weiterhin wurde die These aufgestellt, dass neben Klausuren und Vorlesungen, als übliche Prüfungs- und Unterrichtsformen, auch andere Formen z.B. mündliche Prüfungen, Moot-Courts oder Seminare zugelassen werden sollten. Mit 68,7 % allgemeiner Zustimmung aller Teilnehmenden und lediglich einer allgemeinen Ablehnung dieser These von 12,2% ist der Bedarf nach Reformen eindeutig.
Dies wird auch im Grundsatzprogramm des BRF deutlich. § 6 Grundsatzprogramm erklärt, dass die Beibehaltung klassischer Veranstaltungskonzepte als Grundlage des Studiums dienen und mit innovativen Angeboten ergänzt werden sollen. Ebenso ist eine Reduzierung von Klausuren zugunsten anderer Prüfungsformate wie bspw. Seminare, Moot Courts, Legal Clinics oder mündlichen Prüfungen notwendig (vgl. § 21 Grundsatzprogramm).
Zu 4f: Digitale Lehre
Die These lautet „Vorlesungen und Seminare sollten digitalisiert werden“. 61,1 % der Teilnehmenden sprachen sich für eine Digitalisierung aus, während bloß 15,8 % diese ablehnten.
Dies entspricht der Position des BRF, der sich in § 22 seines Grundsatzprogramms dafür ausgesprochen hat, dass die Hochschulen eine geeignete digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen sollen (Studienorganisation, Datenbanken, Lernplattformen), E-Learning (Nutzung digitaler Medien in der Lehre) gefördert werden soll, sowie Vorlesungsaufzeichnungen und -materialien online zur Verfügung gestellt werden sollen.
Interessant ist hier vor allem, dass Teilnehmende mit einer geringeren Notenstufe die digitale Lehre eher befürworten – ggfs. könnte dies so interpretiert werden, dass Studierende in diesen Notenstufen auch stärker von digitaler Lehre profitieren bzw. ggfs. diese Angebote auch eher nutzen.
Jedoch werden auch – insbesondere wohl von den Professor:innen – die „Schattenseiten“ der digitalen Lehre (Vorlesungen vor „schwarzen Kacheln“, ggfs. mangelnde Interaktion etc.) angesprochen. Der BRF sollte erwägen, solche Sorgen bzw. Missstände bei zukünftigen Positionierungen zu diesem Thema (sofern nicht bereits geschehen) ernst zu nehmen, und sich damit zu beschäftigen, wie diese ggfs. ausgeräumt werden können – insbesondere, da sie hauptsächlich von denjenigen geäußert wurden, die maßgeblich für einen Ausbau der digitalen Lehre verantwortlich sind bzw. Entscheidungsträger in diesen Belangen sind.
Zu 4g: Rechtsdidaktik
Diese These lautete „An den Universitäten braucht es eine verstärkte Auseinandersetzung mit der Rechtsdidaktik“. Hier war die überwiegende und vollständige Zustimmung bei insgesamt 71,2 % aller Teilnehmenden, was mit der Position des BRF übereinstimmt (vgl. § 23 Grundsatzprogramm). Nur 16,9 % der Teilnehmenden standen dieser These neutral gegenüber (Ablehnung: 7,3 %).
Wenig überraschend ist, dass die Professor:innen diese These zu 28,2 % voll oder überwiegend ablehnen, während diese Gruppe unter den Studierenden nur 5,3 % einnimmt. Hierbei sollte aber bedacht werden, dass es sich wohl um ein „Henne und Ei“-Problem handelt: Die große Ablehnung unter den Professor:innen ist wohl deren direkter Betroffenheit geschuldet. Wenn aber aufgrund zukünftiger Reformbestrebungen mehr Studierende „auf dem Weg“ zu einer etwaigen Professur mit Rechtsdidaktik konfrontiert werden, dürfte sich dieser Wert in Zukunft ändern. Insofern sollte der BRF bei entsprechenden Positionierungen bedenken, dass sich das Problem mangelnder didaktischer Kenntnisse der Dozierenden einerseits nur langsam beheben lässt, andererseits aber auch hier offen auf die heutigen Dozierenden zugegangen werden muss und erwägt werden sollte, inwiefern sich deren mögliche „Scham“ über mangelnde didaktische Kenntnisse überwinden lässt (die der maßgebliche Grund für eine fehlende (Bereitschaft zur) Auseinandersetzung mit dem Thema sein dürfte).
Zu 4h: Auslandsaufenthalte
Diese These lautet „Es sollten verpflichtende Auslandsaufenthalte in das Studium integriert werden“. Das Grundsatzprogramm des BRF (siehe dort § 29 Abs. 4 S. 1) vertritt diese These nicht in dieser Absolutheit, sondern spricht sich nur dafür aus, dass alle Studierende die Möglichkeit haben müssen, ein Auslandsstudium zu absolvieren. Die Position des BRF deckt sich (jedenfalls im – logisch aber wohl nicht einwandfreien – Umkehrschluss) mit den Ergebnissen der Befragung: Bei 52,1 % aller Teilnehmenden traf diese auf Ablehnung; 21,0 % der Teilnehmenden stimmten ihr zu, während sich der zweitgrößte Teil (22,6 %) neutral verhielt.
Besonders signifikante oder diskussionswürdige Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen zeigten sich hierbei nicht.
Zu 4i: Universitäres Repetitorium
Diese These lautete „Das universitäre Repetitorium sollte ausgebaut werden“. Hier liegt der Zustimmungswert bei allen Teilnehmenden bei 83,1 % während die Ablehnung nur bei 1,2 % liegt und 7,2 % sich neutral positionierten. Dies deckt sich mit der Beschlusslage des BRF, der in § 36 seines Grundsatzprogramms ebenfalls für den Ausbau des universitären Repetitoriums plädiert.
Außer, dass die Professor:innenschaft (auch hier wohl aufgrund ihrer ggfs. stärkeren Betroffenheit) im Vergleich zu anderen Berufsgruppen „nur“ eine 72,7 %-ige Zustimmung erklärt hat, ergeben sich hier keine weiteren diskussionsbedürftigen Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen.
Zu 4j: Regelmäßiges Monitoring des Reformbedarfs
Diese These lautet „Es bedarf eines regelmäßigen Monitorings des Jurastudiums unter Einbindung der Studierenden im Hinblick auf einen etwaigen Reformbedarf“. Diese These erhielt eine 76,6 %-ige Zustimmung, während sich lediglich 6,1 % ablehnend und 12,7 % der Teilnehmenden neutral positionierten. Auch wenn sich ein regelmäßiges Monitoring nicht explizit im z.B. Grundsatzprogramm des BRF findet, liegt wohl auf der Hand, dass diese These (und auch das Befragungsergebnis) mit der Position und auch der aktuell geleisteten Arbeit des BRF übereinstimmen (insbesondere hinsichtlich der Einbindung der Studierenden).
Nicht weiter überrascht, dass die Zustimmung hier mit steigendem Alter (leicht) abnimmt. Etwas mehr überrascht, dass die vollständige Zustimmung mit steigender Notenstufe – teils signifikant – abnimmt; ggfs. wird von diesen Teilnehmenden der grundsätzliche Reformbedarf nicht so hoch eingeschätzt.
Naheliegend ist auch, dass die vollständige Zustimmung unter Professor:innen bzw. Mitarbeitenden der LJPAs eher gering ist (24,1 % bzw. 25,7 % gegenüber 62,1 % bzw. 63,5 % bei Studierenden bzw. Referendar:innen).
Insofern sollte der BRF den konstruktiven Austausch zwischen LJPAs bzw. Professor:innen fortführen und ggfs. auch die (Landes-)Fachschaften für Konstruktivität sensibilisieren, um LJPAs und Professor:innen etwaige (Berührungs-)Ängste vor dem Austausch mit Studierenden zu nehmen; natürlich stets unter Beachtung des schmalen Grats, nicht zu einem zahnlosen Tiger zu mutieren.
Block 5: Inhalte des Studiums
Zu 5a: Grundlagenfächer stärken
Das Stärken der Grundlagenfächer wurde von der Mehrheit der befragten Student:innen mit einer generellen Ablehnung (46,7%) beantwortet, während ein Übermaß der befragten Professor:innen jener generell zustimmte. Der BRF stimmt der These aber generell zu. Daher ist der BRF insbesondere der Auffassung, dass juristische Fakultäten ein Angebot an Grundlagenfächern aufweisen müssen auch, wenn es hierbei einer Zusammenarbeit über die eigene Fakultät hinaus, mit anderen Fakultäten, bedarf. Eine Stärkung der Grundlagenfächer fördert die Interdisziplinarität in der juristischen Ausbildung und folglich auch die wissenschaftliche Kompetenz der Studierenden.
Zu 5b: Rechtsvergleichung
Die Frage nach der Internationalisierung im juristischen Studium ist in der Betrachtung des Ergebnisses maßgeblich von den jeweiligen Altersgruppen der Befragten sowie von dem Zeitpunkt des Studiums abhängig.
Während 66,7% der 78-jährigen und 28,6% der 69-jährigen der These zustimmen, stößt sie unter den 18jährigen mit 40 und unter den 63-jährigen mit 41% auf Enthaltung. Eine neutrale Einstellung herrscht dagegen unter den 17-jährigen -mit lediglich einer abgegebenen Stimme-. Demgegenüber stehen 18,2% der 35jährigen, welche die These absolut ablehnen.
Unter den Befragten zu dieser These befinden sich keine Personen im Altersbereich zwischen 19 bis 30 Jahren. Jene bilden aber den Großteil der Student: innen der Rechtswissenschaften ab. Des Weiteren ist die Internationalisierung der juristischen Ausbildung eine eher neuerer Diskurs, der mit der Einführung der Bologna-Reform einherging.
Die Internationalisierung des juristischen Studiums ist aus Sicht der Bundesfachschaft wünschenswert. Hierbei spielt die Interdisziplinarität eine große Rolle. Der Blick auf andere Rechtsverordnungen ermöglicht einen Vergleich und demnach auch eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen. Daher müssen Jurastudierende im Verlauf des Studiums unter anderem die Gelegenheit haben ein Auslandssemester zu absolvieren.
Zu 5c: Neue Inhalte nur bei Streichung der bestehenden
Mit einer Mehrheit von 2/3 entsprach genannte These nicht der erwarteten Zurückhaltung. Das Professorium stimmte der These ebenso mit 70,6% zu. Das Studium sowie die erste juristische Staatsprüfung quellen inhaltlich über. Nicht umsonst ist das juristische Studium ein „Kampf gegen das Vergessen“. Der BRF kann sich dieser These nur anschließen. Wir gehen insofern noch weiter, indem wir sogar eine umfangreiche Stoffreduzierung im Jurastudium fordern. So könnten neue Inhalte zum Beispiel in einem Wahlpflichtfachbereich behandelt werden. Welche Inhalte aber weiterhin fester Bestandteil des Studiums sein und welche durch Streichung anderer hinzukommen sollten, ist eine Frage, derer es längerer Diskussionen bedarf.
Zu 5d: Softskills
Auch dieser These schließt sich der BRF uneingeschränkt an. Die hohe Zustimmung über alle Alters- und Berufsgruppen hinweg beweist, dass die Nachfrage, sowohl bei den Auszubildenden als auch in der Praxis nach gut ausgebildeten Soft Skills notwendig ist. Hierbei ist insbesondere darauf hinzuwirken, dass die Schlüsselqualifikationen qualitativ und quantitativ aufgewertet werden.
Zu 5e: Rechtsgebietsübergreifende Ausbildung
Eine rechtsgebietsübergreifende Ausbildung ist hinsichtlich eines vernetzten Ansatzes und dem besseren Verständnis hinsichtlich der rechtlichen Materie sicherlich wünschenswert und könnte durchaus auch in die bestehenden Konzepte ergänzt werden. Der BRF spricht sich jedoch dagegen aus, dass Klausuren gebietsübergreifend gestellt werden. Angesichts der bestehenden hohen Herausforderungen und dem psychischen Druck sollte man die Studierenden nicht mit noch mehr Ungewissheiten belasten. Die vorsichtige Zustimmung und die vielen Enthaltungen in der Umfrage spricht auch dafür, erst einmal einige Anreize und Ansätze zu setzen, um das vernetzte Lernen zu fördern.
Zu 5f: Diversitätskompetenz
Dass die Gesamtheit der Jurastudierenden insgesamt relativ homogen ist und sich nicht besonders durch eine hohe Diversität auszeichnet ist relativ offensichtlich. Gerade deswegen ist es unserer Sicht enorm wichtig, dass Diversitätskompetenz im Studium umfassend vermittelt wird. Denn nur so können Jurist:innen später in ihren jeweiligen Tätigkeiten den gesellschaftlichen Realitäten Rechnung tragen. Der BRF setzt sich in seinem Grundsatzprogramm in §§ 50 und 51 für Antidiskriminierung und Gleichstellung ein: Das fängt bei klischee- und stereotypenfreien Sachverhalten an und geht bis hin zu paritätisch besetzten Berufungskommissionen. Dennoch dürfen die Bemühungen dort nicht aufhören: Wir als Jurist:innen müssen die gesellschaftliche Realität in ihrer Diversität widerspiegeln: nur so können alle Perspektiven, wie die von Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen in Armut, von Sexismus oder Rassismus Betroffenen und geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten in Rechtssetzung, -anwendung und -forschung mit einfließen.
Dass die Zustimmung in den jüngeren Altersgruppen verhältnismäßig höher ist, unterstreicht die wachsende Sensibilität für Diversität bei jungen Menschen. Es muss jedoch zu denken geben, dass sich die Zustimmung insgesamt nur in Grenzen hält, gerade unter den männlichen Befragten, wo die Zustimmungswerte als nur halb so hoch wie bei den weiblichen und diversen Befragten angegeben wurden. Dies muss den Anlass geben, dass sich Studierende auch mit ihren Privilegien auseinandersetzen müssen. Insgesamt ist aus Sicht des BRF eine (verstärkte) Vermittlung von Diversitätskompetenz in der juristischen Ausbildung unabdingbar. Weiterhin muss die juristische Ausbildung an sich diverser werden!
Zu 5g: Wissenschaftliche Ausrichtung des Studiums
Der BRF schließt sich der Forderung an, dass das juristische Studium wissenschaftlich ausgerichtet sein soll. Hervorzuheben ist hier vor allem der Schwerpunktbereich. Wir fordern außerdem in § 20 des Grundsatzprogramms, dass jede Fakultät Veranstaltungen zur spezifischen Vermittlung von Wissenschaftskompetenz anbietet. So können wissenschaftliche Inhalte auch regelmäßig in Vorlesungen und Seminaren integriert werden. Die Zustimmung unter den Studierenden verdeutlicht die Nachfrage. Jedoch darf bei aller Zustimmung nicht vergessen werden, dass die juristische Ausbildung auf juristische Berufe vorbereiten soll. Die Vermittlung der dazu notwendigen Kompetenzen muss daher weiter im Zentrum der Ausbildung stehen.
Zu 5h: Stärkere Einbindung der Professor:innen
Die stärkere Einbindung von Professor:innen, insbesondere in die Examensvorbereitung und die -prüfungen ist notwendig, um die Macht der kommerziellen Repetitorien zu brechen. Es sollten diejenigen prüfen, die die Studierenden auch ausbilden. Die hohe Zustimmung unter allen Teilnehmenden sollte den Professor:innen und den JPAs als Ansporn dienen diesem Ziel gerecht zu werden. Wir fordern vor allem die Professor:innen aus, sich mehr in die Examensvorbereitung und die -prüfungen einzubringen und weiterhin die Lehre stetig und kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehört es aus unserer Sicht insbesondere, dass Professor:innen eine rhetorische und fachdidaktische Aus- und Weiterbildung erfahren (vgl. § 23 des Grundsatzprogramms). Wir freuen uns in jedem Fall, weiter mit den Professor:innen über die Reformen der juristischen Ausbildung zu diskutieren.